


In der vergangenen Ausgabe haben wir die Vorgeschichte zur nationalsozialistischen Machterlangung in Deutschland bzw. ganz konkret in Südthüringen thematisiert. In den Jahren zwischen der Niederschlagung des Kapp-Putsches 1920 durch antifaschistische Kampfverbände aus der Arbeiterschaft bis zum Machtantritt Hitlers 1933 erlitt die deutsche Linke ihre schwerste Niederlage. Diese bestand nicht nur darin, der Machterlangung der Nationalsozialisten, u.a. durch innerlinke Grabenkämpfe, nichts entscheidendes mehr entgegensetzen zu können, sondern auch in der Tatsache, dass nicht geringe Teile der damaligen Arbeiterschaft zur NSDAP überliefen und statt einer sozialistischen Alternative zur kapitalistischen Ausbeutung die Barbarei wählten. In dieser Ausgabe wird es um die erste Phase des antifaschistischen Widerstandskampfes gegen das nationalsozialistische Deutschland gehen, um die Jahre von Hitlers Machtantritt 1933 bis zum Kriegsausbruch 1939.
In den industrialisierten Regionen des Thüringer Waldes lagen die Hochburgen der linken Arbeiterparteien und des antifaschistischen Widerstandes. Noch Anfang des Jahres 1933 waren die Betriebs-, Stadt- und Gemeinderäte etwa um Suhl eher durch KPD und SPD dominiert als durch die NSDAP. Trotzdem kam es auch hier nicht zu dem von der KPD ins Auge gefassten Generalstreik gegen Hitlers Machtübernahme und hierin liegt der wohl sichtbarste Unterschied zur Situation von 1920 und 1923. 1933 gab es eben keinen Staatsstreich, keinen Putsch, sondern eine demokratisch eingeleitete Machtübernahme durch eine Bewegung, die tatsächlich die Mehrheit der Deutschen hinter sich versammelte. Die gespaltene Linke hatte dem nichts mehr entgegensetzen können.
Trotzdem: Der Versuch war da – zumindest in den genannten industrialisierten Revieren im Thüringer Wald. In der Nacht nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, also vom 30. zum 31. Januar 1933, vor Beginn der Frühschicht, verteilten Arbeiter vor den Werktoren, u.a. der Simson-Werke, Handzettel mit Aufrufen zum Generalstreik – leider vergeblich. Der Großteil der Belegschaft nahm die Arbeit auf. Trotzdem kam es am 1. Februar 1933 auf dem Suhler Marktplatz zu einer antifaschistischen Protestkundgebung von ca. 2.000 Menschen aus den Betrieben der Stadt und des Umlandes. Weitere Kundgebungen fanden in Zella-Mehlis (ca. 400 Teilnehmer) und Sonneberg statt. Sie konnten die Entwicklung nicht aufhalten. Ab 2. Februar waren per Landespolizeiverordnung ohnehin alle Versammlungen der KPD unter freiem Himmel verboten.
An der ersten Widerstandsphase zwischen 1933 und 1938/39, also von der Machterlangung der NSDAP bis zum Kriegsausbruch bzw. dessen unmittelbaren Vorläufern, beteiligten sich vor allem die schon seit Jahrzehnten erklärten Gegner des Faschismus: Kommunisten, Sozialdemokraten, Anarchisten und Gewerkschafter. Von der NS-Terrorwelle überrollt, wurden zumindest hier und da an der sozialdemokratischen und kommunistischen Basis, wo sie eine antifaschistische war, die Gräben zugeschüttet. Im Widerstand hatte man kaum eine andere Wahl. Vertrauen und Verlässlichkeit spielten im Widerstand eine große Rolle. Trotzdem kam es immer wieder zu Bespitzelung und Verrat.
Der Historiker Gerd Kaiser beschreibt die soziale Zusammensetzung des Widerstandes in unserer Region als Aktivitäten von i.d.R. politisch gebildeten und aktiven, beruflich erfahrenen Arbeitern, die zum Teil auf jahrzehntelange Erfahrungen in politischen Parteien und Strömungen der Arbeiterbewegung zurückblicken können. Diese erste Phase des Widerstandes war also dominiert durch ein gut gebildetes und aufgeklärtes Industriearbeiterklientel im Alter zwischen Mitte 30 bis Mitte 60 und hatte ihre Zentren in den Orten mit Großbetrieben der Metall- und Waffenindustrie, der Glas- und Porzellanindustrie, aber auch – etwa im Raum Sonneberg – in Mittel-, Klein- und Handwerksbetrieben, etwa der Spielzeugfertigung.
Hochburgen der Thüringer Faschisten waren unter anderem die Universitätsstädte, wo sich Burschenschafter und andere Studentenverbindungen in Scharen der NSDAP anschlossen. Zudem war die NSDAP dort stark, wo Landarbeiter, Mittelstand, Beamte und Kleinbürgertum dominierten, etwa in Meiningen, Schleusingen oder Hildburghausen.
Anfang des Jahres 1933 wurde die KPD sukzessiv durch Betätigungsverbot und den Einzug des Parteivermögens außer Gefecht gesetzt, Vereine und Organisationen der Arbeiterbewegung wurden verboten, Funktionäre wurden verhaftet und in die ersten Konzentrationslager gesteckt. Die Parteiarbeit wurde an vielen Orten und auch im Südthüringer Raum in der Illegalität fortgesetzt. Diejenigen, die sich widersetzten, blieben aber stets eine Minderheit, die zusammenschrumpfte mit jedem Jahr der Repression und die Rückschläge erlitt mit jedem ehemaligen Funktionär aus der Arbeiterbewegung, der sich den Nazis andiente oder sogar Verrat übte. Vielfach zogen sich einstmalige Anhänger der Arbeiterbewegung ins Private zurück, wo sie nicht gleich zu den Faschisten überliefen.
Die Widerstandsgruppen in Südthüringen überlebten und betätigten sich zunächst vor allem als Splittergruppen. Diese Widerstandsgruppen sahen sich immer wieder mit größeren und kleineren Verhaftungswellen und Prozessen konfrontiert, ihre Akteure saßen oft wiederholt und für viele Jahre in Gefängnissen. Alles in allem lässt sich sagen: KPD und SPD waren, anders als die Anarchisten der Region, die sich seit 1930 sukzessiv für die Illegalität wappneten, auf das Überleben und Kämpfen in der Illegalität miserabel vorbereitet, sodass die Repressionen der ersten Jahre durchaus Wirkung zeigten. Zwar hatte es zu Anfang der 30er Jahre bei der KPD Lehrgänge über die illegale Arbeit gegeben. Deren Nutzen fiel aber am Ende gering aus. Über die Jahre des Widerstandes hinweg, gelang es den Nationalsozialisten immer wieder, Widerstandsstrukturen zu zerschlagen. Die Repressionen verliefen auch deswegen so wirkungsvoll – und das darf nicht vergessen werden –, weil die deutsche Beamtenschaft, allen voran Polizei und Justiz sich ohne zu zögern oder schon während der Weimarer Republik dem Naziregime anschlossen und zur Verfügung stellten. Viele, die in den ersten Jahren Widerstand leisteten, stellten nach den ersten Verhaftungswellen ihre Aktivitäten ein. Andere betätigten sich auch nach dem Absitzen von Haftstrafen, nach Folter und Misshandlungen immer wieder im Widerstand.
Im Jahr 1933 verfügte die KPD noch über ein sich über weite Teile Thüringens erstreckendes Netz aus Aktivisten, das sogar bis Oktober eine illegale Zeitschrift, das „Thüringer Volksblatt“, herausgab. Jenes Netz wurde durch die Arbeit eines Gestapo-Spitzels im engeren Kreis der illegalen KPD-Leitung zerschlagen: Erich Thieme. Unter anderem Thiemes Verrat verdankten es die Nationalsozialisten, dass die Gestapo bis November 1933 in Thüringen 8.000 Mitglieder der KPD verhaften konnte.
Die ersten flächendeckenden Verhaftungen von KPD-Mandats- und Funktionsträgern in unserer Region gab es im Landkreis Hildburghausen schon am 28. Februar und 1. März 1933 auf Anordnung des Landrates. Am 3. März kam es zur öffentlichen Verbrennung von Eigentum des Arbeiter-Central-Vereins in Albrechts (Bücher, Noten, Instrumente, etc.), in dem sich verschiedene Arbeitervereine zusammengeschlossen hatten. Zu solchen Aktionen kam es in der Folgezeit an ungezählten Orten. In den ersten Monaten nach der Machterlangung der Nationalsozialisten ging man mit Polizei, SA und SS gegen Arbeiterquartiere, gegen Strukturen von Sozialdemokraten und Kommunisten mit äußerster Härte vor. Die kommunistischen Abgeordneten von Zella-Mehlis wurden im März 1933, nach den letzten freien Wahlen, in das Zuchthaus Untermaßfeld gebracht, wo sich bis Mitte März 34 „Schutzhäftlinge“ aus dem Kreis Meiningen befanden. Mitglieder des kommunistischen Jugendverbandes saßen wegen Weiterbetätigung mehrere Monate vom 9. August 1933 bis zu ihrer Verurteilung am 30. Januar 1934 in Untersuchungshaft im Polizeigefängnis im Rathaus Zella-Mehlis. Sie wurden am Ende wegen des Verkaufs von Beitragsmarken – mehr konnte man ihnen nicht nachweisen – zu Gefängnisstrafen zwischen 12 und 16 Monaten verurteilt. Weitere Männer und Frauen, die potentiell Widerstand hätten leisten können, wurden in die ersten wilden Sammellager und frühen KZs der Anfangsjahre in Nohra und Bad Sulza verbracht. Die Gefangenen warteten dort auf die ersten sogenannten Hochverratsprozesse und die anschließende Verlegung in reguläre Haftanstalten.
Im früh errichteten KZ Bad Sulza befanden sich Ende des Jahres 1933 insgesamt 121 Männer und Frauen aus dem Arbeiterwiderstand im Thüringer Wald und der Vorderen Rhön. Sie kamen u.a. aus Geschwenda, Gräfenroda, Hildburghausen, Ilmenau, Katzhütte, Scheibe-Alsbach, Sonneberg, Steinheid, Unterkatz und Zella-Mehlis. In den ersten Prozessen vor dem OLG Jena um den Jahreswechsel 1933/34 herum wurden allein 31 Antifaschisten aus der Region um Suhl verurteilt. Noch im Jahr 1935 berichtete der Generalstaatsanwalt Thüringens von 785 politischen Häftlingen in Thüringer Gefängnissen. Im Folgejahr 1936 verhaftete die Gestapo wegen antifaschistischer Betätigung 344 Menschen. Reichsweit waren es mehr als 13.000.
Einer der ersten von den Nationalsozialisten ermordeten Antifaschisten aus unserer Region war der Sozialdemokrat und ehemalige Märzkämpfer Ludwig Pappenheim aus Schmalkalden, der einer jüdischen Kaufmannsfamilie entstammte. Pappenheim wurde am 25. März 1933 verhaftet, durchlief verschiedene Haftanstalten und wurde schließlich ins KZ-System der Moorlager im Emsland verschleppt. Dort erschoss man ihn am 4. Januar 1934. Seit 2005 erinnert die Gedenkstätte Yad Vashem in Israel an Pappenheim. Von 1945 bis 1990 hieß ihm zu Ehren Kleinschmalkalden Pappenheim.
Die Widerstandshandlungen, die durch die verschiedenen Gruppen organisiert wurden, waren vielfältig. Sie reichten von passivem Widerstand durch Nichtmitgliedschaft in NS-Massenorganisationen oder Entziehung vor Dienstverpflichtungen bis hin zu aktiver Intervention über illegale Flugschriften, Aufklärung der Bevölkerung und zu Kriegsbeginn Sabotagen in den Rüstungsbetrieben. Diese Arbeit wurde u.a. durch illegal weiter arbeitende Parteistrukturen ermöglicht, die Gelder und Infrastruktur sammelten und bereitstellten. Die illegale Parteiarbeit der KPD in der Region um den Thüringer Wald organisierte bis April 1934 Walter Molle, der mit Hilfe von Willy Zimmermann aus Albrechts in Suhl und mit Hilfe von Hans und Else Raßmann in Zella-Mehlis illegale Betriebszellen der Partei aufrecht erhielt. Molle wurde im April 1934 verhaftet und blieb bis zu seiner Befreiung 1945 durch die Alliierten in Haft. Er durchlief zahlreiche KZs der nationalsozialistischen Terrorwelt.
Der angesprochene Willy Zimmermann organisierte mit Alfred Schlegelmilch eine der frühen illegalen Widerstandsgruppen im Simsonwerk. Die Gruppe unterhielt über ihre Mitglieder Kontakte in die umliegenden Industriearbeiterdörfer, verteilte in der Belegschaft Flugblätter und Zeitschriften, wie die „Rote Fahne“ und das „Thüringer Volksblatt“ und versuchte so die Belegschaft gegen die nationalsozialistische Führung aufzubringen.
Im Ilm-Kreis organisierte der kommunistische Glasmacher Rudolf Hermann aus Großbreitenbach eine frühe Widerstandsgruppe, die aufflog, worauf Hermann 1934 mit 36 anderen Antifaschistinnen und Antifaschisten vor dem OLG Jena zu Haftstrafen im Zuchthaus Untermaßfeld verurteilt wurde und später wegen Wiederbetätigung im Widerstand von 1944 bis zur Befreiung am 11. April 1945 im KZ Buchenwald interniert wurde. Hermann erlebte die Befreiung durch den Häftlingsaufstand, den die heranrückenden Amerikaner ermöglichten. Später wurde er Bürgermeister Großbreitenbachs. Einige Jahre nach der Gründung der Gruppe um Hermann, etwa in den Jahren 1936/37, gründete sich im heutigen Ilm-Kreis die Widerstandsgruppe um Karl Zink und Georg Link aus Ilmenau, eine der größten Widerstandsgruppen in unserer Region. Zeitweise sollen bis zu 200 Antifaschistinnen und Antifaschisten aus der Region dort organisiert gewesen sein. Die Gruppe sammelte und verteilte Geld, um die illegale Arbeit und die Familien Verfolgter zu unterstützen. Nach den Erinnerungen von Georg Link verfasste die Gruppe Flugblätter, die sie zunächst in Höfen und an belebten Straßen ablegte. Später als stabile Verbindungen durch Vertrauensleute in Betriebe geschaffen worden, verlagerte sich die Aufklärungsarbeit gegen Faschismus und Krieg dorthin. Die Gruppe ist nach Karl Zink benannt, einem 1910 in Zella-Mehlis geborenen Eisendreher, der bei KPD, Roter Hilfe sowie im Arbeitersport aktiv war und sich seit Anfang der 30er Jahre gegen die faschistischen Tendenzen engagierte. Er organisierte die weithin vernetzte Widerstandsgruppe und war neben Georg Link der einzige, der alle Vertrauensleute kannte. 1935 wurde Zink zum ersten Mal zusammen mit weiteren 15 Antifaschisten verhaftet und zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er durchlief mehrere Knäste und KZs. Nach seiner Haft betätigte er sich wieder mit seiner Gruppe im Widerstand. Zink gab in der Region Arnstadt-Ilmenau-Zella-Mehlis eine Folge regelmäßiger Flugschriften unter dem Namen „Antifa“ heraus. Er wurde am 1. September 1939, dem Tag an dem die Wehrmacht mit ihrem Einmarsch in Polen den Zweiten Weltkrieg begann, an seinem Arbeitsplatz in Ilmenau verhaftet, wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt und am 6. September 1940 in Berlin-Plötzensee ermordet. Auch sein Bruder Walter überlebte die NS-Haft nicht. Heute erinnert in Ilmenau ein Denkmal und eine nach ihm benannte Straße an den Widerstandskämpfer Karl Zink. Weitere Mitglieder der Widerstandsgruppe waren Arno Geißler (Ilmenau, KPD), der mehrere KZs durchlief, u.a. Buchenwald und 1950 an den Spätfolgen der Misshandlungen starb; Max Kessel (Goldlauter, KPD), mehrjährige Haft, Folter und Strafkolonie, überlebte; Georg Link (Manebach, KPD), durchlief auch mehrere Strafanstalten, u.a. Buchenwald, wurde mehrfach gefoltert und überlebte, Kurt Rauch (Stützerbach), verurteilter Widerstandskämpfer, in Buchenwald ermordet; außerdem: Fritz Schörnig (Arnstadt), Max Bühl (Großbreitenbach), Franz und Otto Oehmus (Pennewitz), Louis Senglaub (Elgersburg), Otto Hellmann (Geschwenda), uvw.

Dem Sozialdemokraten Theo Gundermann aus Sonneberg gelang es, Kontakte zu den sozialdemokratischen und kommunistischen Emigrationszentren in Prag zu halten und über diesen Weg illegale Druckerzeugnisse in den Thüringer Wald zu schaffen und zu verteilen. Im Zusammenhang mit der Verbreitung solcher illegaler Schriften verhängte das OLG Jena am 29. Juni 1936 Freiheitsstrafen gegen Mitglieder einer Widerstandsgruppe aus Möhrenbach, Langewiesen und Gehren. Der Bauarbeiter Walter Heinze aus Gehren erlebte die Befreiung im KZ Buchenwald.
Es mag banal klingen, wenn hier von geschmuggelten und verteilten Flugblättern als Widerstandshandlungen die Rede ist. Banal ist das ganz und gar nicht. Die nationalsozialistische Gleichschaltung hatte alle Printmedien unter Kontrolle, Fernseher gab es noch nicht und empfangsstarke Rundfunkgeräte, die Auslandssendungen empfangen könnten, waren in Arbeiterhaushalten nicht zu finden bzw. waren erst später verbreitet und die Auslandssender wurden vom Regime gestört. Für Informationen über das wirkliche Ausmaß der nationalsozialistischen Herrschaft und über Weisungen aus kommunistischen Führungsgremien und Emigrationszentren waren diese geschmuggelten Druckschriften also von großer Bedeutung und den Herrschenden ein Dorn im Auge.
In dieser Zeit, den ersten Jahren des Naziregimes, verlor der antifaschistische Widerstand in Südthüringen immer stärker an Rückhalt. Das hatte, folgt man Gerd Kaiser, vorrangig zwei Gründe. Erstens: Die soziale Demagogie der Nazis entfaltete ihre Wirkung, weil zweitens die Arbeitslosigkeit durch staatliche Investitionsprogramme und Rüstungsaufträge zwischen 1933 und 1936/37 spürbar zurück ging. Da vor allem die Rüstungsindustrie in der Region des Thüringer Waldes, etwa im Gustloffwerk oder im „arisierten“ und von seinen jüdischen Gründern enteigneten Simson-Werk, das am 1. September 1934 die Automobilproduktion zu Gunsten der Rüstungsproduktion einstellte, besonders stark war, steigerte das auch hier die Zustimmung der Arbeiter für die Nationalsozialisten. Auf die einfache Idee, dass die steigenden Ausgaben für Infrastruktur und Rüstung den Krieg vorbereiteten, kam man entweder nicht oder war damit einverstanden. Weiterhin initiierten die Nationalsozialisten Wohnungsbauprogramme, etwa um Suhl auf dem Lautenberg und dem Friedberg. Die Nationalsozialisten stellten ihren Gefolgsleuten für die Suhler Raub- und Aufrüstungspolitik soziale Wohltaten in Aussicht und köderten Arbeiter mit Geldgeschenken. Nicht wenige ehemalige Funktionäre der Arbeiterbewegung machten mit dem NS-Regime ihren Frieden. Dabei machte der Thüringer NSDAP-Gauleiter Fritz Sauckel keinen Hehl daraus, dass die sozial-demagogische, antisemitische Raubpolitik des NS-Staates in den Krieg münden sollte. Er erklärte im Jahr 1935 auf einer Belegschaftsversammlung im ehemaligen Simson-Werk in Suhl: „Wir stehen hier auf erobertem Boden […]. Ich will nicht nur Besitz ergreifen von den Gebäuden, Grund und Boden, Maschinen – ich will mehr […]. In diesem Werk wollen wir ein Fanal gegen den Bolschewismus errichten […]. Und so verkünde ich euch, daß ihr in diesem großen Betrieb die Waffen herstellen sollt, die im großen Ringen der Welt sich bewähren und die Entscheidung bringen müssen.“
Gerd Kaiser resümiert über die erste Phase des Widerstandes: „Exzessiver Terror, kreatürliche Angst vor möglichen Folgen einer Teilnahme am antifaschistischen Widerstand, Verrat an Überzeugungen, Personen und von illegalen antifaschistischen Strukturen durch bisherige Funktionsträger verschiedener politischer Strömungen der organisierten Arbeiterbewegung, soziale Demagogie, Überwindung der Massenarbeitslosigkeit im Gefolge der systematisch betriebenen Aufrüstung sowie außenpolitische Erfolge des NS-Regimes, hatten – korrespondierend mit Denunziationen durch Anhänger der NSDAP, ihrer Gliederungen und örtlichen Amtsträger, zur Folge, dass sich der organisierte Widerstand in seiner ersten Phase zwischen 1933 und 1938/39 quantitativ abschwächte.“
Ein Ursachenkomplex, der bei Kaiser und anderen lokalen Historikern systematisch unterbeleuchtet bleibt, ist der seit den 20er Jahren um sich greifende und längst zu einer Massenbewegung gewordene Antisemitismus, der an den Juden grundlos, durch pathische Projektion neben den Schattenseiten des modernen Kapitalismus auch seine Errungenschaften verfolgte und an die offene Herrschaft der Gewalt und des Terrors preisgab. Hierin liegt ein nicht nur von Kaiser stellenweise reproduziertes, sondern auch von der illegalen KPD geteiltes, vollkommen falsches Verständnis des Faschismus, das sich in der Faschismus-These von Georgi Dimitroff, 1935 auf dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationalen vorgestellt, zuspitzt. Dimitroff vertrat die These, der Faschismus an der Macht sei „die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“. Jetzt ist einerseits sicher nicht von der Hand zu weisen, dass große Teile des deutschen Kapitals Hitler wollten und unterstützten. Andererseits – und hierin liegt die krachende Leerstelle der Dimitroff-These – der Nationalsozialismus hätte niemals diese Macht entfaltet, wäre er nicht von einer Massenbewegung getragen worden, die im ideologischen Kern eine antisemitische war, d.h. eine, die die Negativfolgen der kapitalistischen Vergesellschaftung auf die abstrakten Elemente des Wirtschaftswesens, also jenes Finanzkapital projizierte und in den Juden zu verfolgen suchte. Der Nationalsozialismus war keine Diktatur einer reaktionären Elite über die Mehrheit der kleinen Leute, sondern eine von der Mehrheit der kleinen Leute gewollte Revolte gegen die Aufklärung, gegen Kosmopolitismus und eine solidarische und offene Gesellschaft. Wäre das mehr antifaschistischen Akteuren damals klar gewesen, wären sie vielleicht hier und da nicht in offene Messer gelaufen, wenn sie sich regimekritisch gegenüber Kollegen geäußert und diese bei bestimmten Aktionen ins Vertrauen gezogen hätten und sie hätten vorhandene Strategien grundlegend überdenken können. Die deutsche Volksgemeinschaft, gegen die sich der Widerstand letztlich zu stemmen hatten, war keine von den Nazis übertölpelte Masse, der die Beweggründe deutscher Politik unklar waren, sondern die deutsche Volksgemeinschaft wollte den Krieg und die Vernichtung.
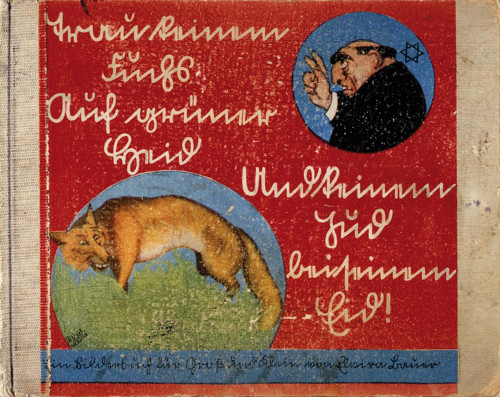
Zusammenfassend zur ersten Phase des Widerstandes lässt sich festhalten, dass die in unserer Region durchaus vorhandenen Widerstandsgruppen nie eine Gegenbewegung entfalteten konnten, die das Regime ernsthaft im Bedrängnis hätte bringen können. Das schmälert die Leistungen und Absichten des Widerstandes in keiner Weise. Ganz im Gegenteil: In dem Wissen, dass jede ihrer Taten beim Auffliegen schlimmste Konsequenzen nach sich ziehen konnten, bewiesen die Widerstandskämpfer vor allem eines: Es war möglich, aber die Mehrheit der Deutschen wollte den Krieg, Hitler und die Vernichtung.
Im dritten und letzten Teil unserer Reihe zur Geschichte des Widerstandes in Südthüringen wird es um die zweite Phase des Widerstandes gehen, jene Jahre vom Kriegsbeginn bis zur deutschen Niederlage.