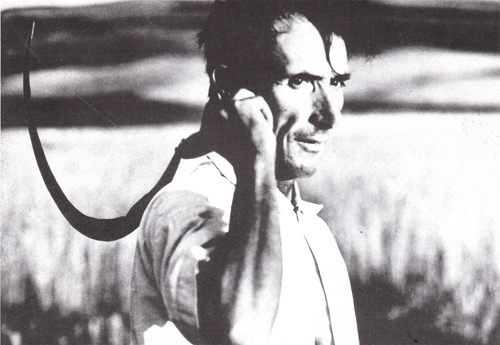In der letzten Ausgabe der Alerta Südthüringen haben wir begonnen einen linksradikalen, ideologiekritisch-begründeten Antifaschismus in seinen Grundzügen zu skizzieren, indem wir über Erkenntnisse aus der Kritik der Warengesellschaft und ihrer Ideologie geschrieben haben. Jene Ideologie wird durch Ideologiekritik nicht als die gewollten Vorgaben, Dogmen oder Denkgebote einer herrschenden Klasse kritisiert, sondern als ein der falschen Gesellschaft angepasstes Denken, das die Betroffenen wie ihre Apologeten gerne als „gesunden Menschenverstand“ oder als eine wie weit auch immer degenerierte Form von „Vernunft“ missverstehen. Jedoch ist die Ideologie der Warengesellschaft alles andere als vernünftig oder gar gesund, sie ist, mit einer Wendung von Marx, notwendig falsches Bewusstsein.
Und was solches notwendig falsches Bewusstsein den Menschen verstellt, ist der Blick auf die Tatsache, dass sie für das wesentliche Bewegungsgesetz der Gesellschaft austauschbare und tendenziell - mit steigender Rationalisierung des Produktionsapparates – überflüssige Momente eines Ganzen sind, das nicht dazu da ist, ihre Bedürfnisse zu erfüllen oder sich von ihnen vernünftig einrichten zu lassen, sondern das sie bewusstlos verinnerlichend immer wieder reproduzieren, während es sie zu Objekten einer neuen Sklaverei macht. Das Wissen der Einzelnen um die Austauschbarkeit und Überflüssigkeit, so sehr es von falschem Schein des unerfüllten bürgerlichen Glücksversprechens übertüncht ist, ist nicht getilgt. Es bricht sich Bahn in der Angst im endlosen kapitalistischen Dynamisierungsprozess abgehängt zu werden, zu dem zu werden, was man tendenziell schon ist, aber nicht sein will: Objekt – Objekt von Staatsaktionen, von Armenfürsorge, Objekt des Arbeitsamtes oder der Polizei. Um sich nun vor der Einsicht in die eigene Überflüssigkeit zu schützen, haben sich für das Subjekt, das Subjekt bleiben will, ganz bestimmte Ideologien herausgebildet, mit denen es seiner Existenz Sinn gibt, sie aufwertet, indem sie andere abwertet. Diese Ideologien sind die des Rassismus und des Antisemitismus. Beide versteht der ideologiekritische Materialismus nicht als subjektive Verfehlungen vieler einzelner Irrläufer, denen mit Menschenrechten, Sozialarbeit und Erziehung kurzerhand abzuhelfen wäre. Der ideologiekritische Materialismus begreift sie als gesellschaftliche Verhältnisse, also als Produkte der materiellen gesellschaftlichen Ordnung, in denen sie entstehen und in denen sie eine wichtige Funktion zur Rechtfertigung und zum Erhalt jener Ordnung einnehmen.
Das Alltagsverständnis von Rassismus besagt, dass der Rassist Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ganz einfach aufgrund äußerer Merkmale als minderwertig oder doch zumindest als andersartig, als fremd bewertet. Wovon das rassistische Bewusstsein im Alltagsverständnis sich abgrenzen will, ist ein durch bestimmte Merkmale (Physiognomie, „Kultur“, etc.) klassifiziertes Kollektiv, zu dem man das eigene ins Verhältnis setzen will – eine Definition, für die es keine fünf Minuten Wikipedia-Studium bedarf. Man könnte hierbei also von einem kulturellen Rassismus reden oder – viel treffender – von ordinärer Fremdenfeindlichkeit, der Verachtung gegen eine andersartig klassifizierte Kultur.
Die Existenz dieses Hasses in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen zu bestreiten, wäre abwegig. Vielmehr gilt festzuhalten, dass sich dieser Hass aufs Fremde als eine Projektionsleistung des rassistischen Subjekts entpuppt. So stellt sich bei näherer Analyse beispielsweise die vermeintliche Ungehemmtheit, Bindungslosigkeit und sexuelle Freizügigkeit, die der Rassist in den Roma projiziert, als Verdrängung bzw. projektive Abspaltung der eigenen Wünsche und Begierden heraus. Vielfach will der Rassist also am Ausländer exekutieren, was er an sich selbst nicht dulden kann, weil Moral und ökonomischer Zwang ihn daran hindern, weil er sich, um der Sicherheit willen, an das in dieser Reproduktionsordnung geltende Realitätsprinzip kettet. Oder in den Worten des Ideologiekritikers Gerhard Stapelfeldt kurz und bündig zusammengefasst: „Die Selbstunterdrückung vollendet sich in Fremd-Unterdrückung; die Selbst-Liquidierung durch Anpassung an herrschende Mächte vollendet sich in Liquidierung des Fremden.“ Die rassistische Angst vor fremden Sitten und Gebräuchen ist vielfach nichts anderes als die verdrängte Sehnsucht danach bzw. nach dem, was man sich darunter vorstellen will. Denn zumeist entspricht die rassistische Projektion keiner Struktur in der Wirklichkeit. Der Rassismus bedarf nicht einmal der Existenz von Menschen verschiedener Hautfarben oder Religionen, sondern spiegelt nur das aktuelle gesellschaftliche Verhältnis wider. Das zeitgemäße Paradebeispiel liefern die Rassistenaufmärsche der vergangenen Jahre, die sich gegen eine vermeintliche Islamisierung richteten. Sie waren gerade dort am stärksten vertreten, wo der Anteil der muslimischen Bevölkerung verschwindend gering ist: in Ostdeutschland. Dabei betreiben die Islamhater von PEGIDA und AfD alles andere als die durchaus notwendige, aber von diesen Leuten gar nicht zu leistende, Kritik am politischen Islam. Sie motiviert eine Mischung aus ordinärer Fremdenfeindlichkeit und Neid auf die Kopfabschneider des Propheten, die sie um ihre Todessehnsucht, Entschlossenheit, Schlagkraft und das Bekenntnis zur Tradition beneiden.
Als Widerspiegelung des aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisses bzw. als dessen Rechtfertigung ist die dargestellte ordinäre Fremdenfeindlichkeit keineswegs die wesentliche Erscheinungsform des Rassismus, sondern möglicherweise nur ein Oberflächenphänomen der eigentlichen rassistischen Triebfeder. Der Rassismus der Mehrheitsgesellschaft, der heute eng mit Namen wie Thilo Sarrazin verknüpft ist, hasst an den Migranten weniger das, was sie von den Einheimischen unterscheidet und was man als multikulturelle Folklore im Zirkus oder als „südeuropäischen Temperament“ im Bordell gerne bereit ist zu tolerieren, sondern jener Mehrheitsrassismus hasst vor allem das an den Ausländern, was diese mit ihm gemeinsam haben. Wolfgang Pohrt brachte das in einem Essay von 1986 auf den Punkt:
„Zum Ärgernis werden sie [die Ausländer] also nicht durch die Fremdheit ihrer besonderen Kultur, sondern dadurch, daß sie wie die Einheimischen Arbeitsplätze und Wohnungen brauchen, daß sie sich einen Mercedes kaufen, in die Disco gehen und die Kaufhäuser bevölkern. Gehaßt an den Ausländern wird nicht ihre Andersartigkeit, sondern ihre Ähnlichkeit mit den Einheimischen, die sich unvermeidlicherweise aus der Tatsache ergibt, daß sie am selben Ort und unter den selben Bedingungen wie die Einheimischen leben. Vergeblich sind deshalb alle Versuche, durch multinationale folkloristische Beschnupperungsfeste bei den Einheimischen Sympathie für die Ausländer zu wecken, denn Sympathie für deren Folklore war ohnehin schon vorhanden. Vergeblich sind deshalb alle Versuche, um Verständnis bei den Einheimischen für die fremde Kultur zu werben, denn gerade weil die Ausländer keine unbegreiflichen exotischen Menschenfresser sind, die auf Jahrmärkten hergezeigt werden, kann man sie nicht leiden. Gerade weil sie so wenig fremd sind, weil sie mit den bundesrepublikanischen Verhältnissen so wenig Probleme haben, daß sie im Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze und Wohnungen mithalten können, werden sie gehaßt. Das Gerede von den verschiedenen Kulturen [...] dient dazu, der Feindschaft gegen Ausländer edle Motive nachzusagen, während es in Wahrheit dafür nur einen niederen Beweggrund gibt, nämlich den blanken Futterneid.“
Dieser Rassismus, in dem sich eben der gesellschaftliche Verdrängungswettbewerb und das Konkurrenzverhältnis ausspricht, in das die Menschen durch das Kapitalverhältnis getrieben werden, ist eben ein ökonomisch-bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis. Der Rassist fürchtet den Ausländer als Konkurrenten um die im Kapitalismus künstlich verknappten Zugänge zum Wohlstand und er erhofft sich Solidarität – in Wahrheit nur ein Verfallsprodukt einer solchen – in einer Gemeinschaft, die ihn bloß aufgrund des Zufalls seiner Geburt schützt; ihn schützt, weil seine Eltern zufällig auch Deutsche waren und sich die Deutschen im globalen Wettbewerb zur Seite stehen sollten. Der Rassist erkennt das Problem nicht im Kapitalverhältnis, das man gemeinsam mit den Ausländern abschaffen könnte, sondern er erkennt es im Ausländer, den er im Zweifel wegen des herrschenden Kapitalverhältnis und freilich ohne das Wissen darum abschaffen würde. In solcher Verkennung besteht das falsche Bewusstsein des Rassismus und als solches ist es in der bürgerlichen Gesellschaft nahezu Common Sense. Der ehemalige Ministerpräsident Bayerns, Günther Beckstein, brachte es im Jahr 2000 in einem Interview mit der der Liberalen-Illustrierten Focus auf den programmatischen Satz: „Wir brauchen weniger Ausländer, die uns ausnützen, und mehr, die uns nützen.“ In diesem Satz bündelt sich die Realität des ökonomischen Rassismus: Fachkräfte und Investoren – ja; Flüchtlinge und Verfolgte – nein. Solcher Rassismus verkennt, dass der Hunger und die u.a. daraus resultierenden Verteilungskämpfe und die Fluchtbewegung aus der dritten ein Produkt der ersten Welt und ihrer sich weltweit durchsetzenden Produktionsweise sind und dass wer wirklich den Hunger abschaffen will, das System abschaffen muss, das für den Hunger sorgt, den Kapitalismus. Ganz ähnlich verhält es sich mit den Ursachen der Fluchtbewegung, die durch islamistischen und/oder autokratischen Terror ausgelöst wurde. Auch diese Bewegungen sind nichts, woran der globale Kapitalismus und seine Verfallsformen unbeteiligt wären. Ganz im Gegenteil, ist der Islamismus ähnlich wie übrigens auch der Faschismus nur zu verstehen als autoritärer Ausweg aus der globalen Krise des Kapitalismus.
Seine Notwendigkeit hat das falsche Bewusstsein des Rassismus in seinem Ursprung, der politökonomischen Struktur der Gesellschaft und ihrer Subjekte. Diese generieren ihre Identität durch die Teilhabe am System, die Möglichkeit ihre Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Der Rassismus des bürgerlichen Subjekts kommt dann zur Geltung, wenn diese Teilhabe etwa durch steigende Arbeitslosenzahlen ins Stocken zu geraten droht. In solchen Krisen wird das bürgerliche Subjekt seiner eigenen Überflüssigkeit für ein System gewahr, in dem es seine Identität konstituiert und das sich seiner Subjektivität aufgeprägt hat. Gerhard Stapelfeldt bringt diesen Sachverhalt auf den Punkt:
„Arbeitslosigkeit [bedeutet] einen starken Verlust des Selbst-Wertes, weil das Selbst seinen Wert in der Heteronomie der entfremdeten Arbeit, nicht in sich selbst besitzt. Aus dieser Heteronomie resultiert endlich die Strategie der Anpassung an die Entfremdung, umgekehrt: der Ausgrenzung Fremder, die jenem Zwang scheinbar nicht unterworfen sind.“
Aus der Angst vor der eigenen Entwertung, vor dem Abgehängtwerden im gesellschaftlichen Prozess, speist sich der Rassismus und der als „Untermensch“ stilisierte verkörpert eben jene Folgen, die eine nun drohende Niederlage in der kapitalistischen Konkurrenz mit sich bringt. Deshalb versucht der Rassist die Schwarzen, die Flüchtlinge oder Ausländer von sich fern zu halten, weil sie vermeintlich seine eigene Existenz bedrohen und ihm die drohende Niederlage in der unverstandenen bzw. als Naturverhältnis missverstandenen Produktionsordnung vor Augen führen. Sie stellen sich ihm als „minderwertige“ dar, weil sie nicht zur Verwertung gebraucht werden.
Um also das Problem des Rassismus noch einmal zuzuspitzen: Der Rassist verachtet den Schwarzen, weil er in ihn das projiziert, was von seiner eigenen Charaktermaske, seines sich in seiner gesellschaftlichen Funktion erschöpfenden Selbst, nach Abzug ihrer Verwertbarkeit übrig bleibt: krude Natur. Das gesellschaftliche Verhältnis des Rassismus ist also zusammenfassend zu bestimmen als ein dieser Gesellschaftsordnung notwendig innewohnender Mechanismus, der den modernen Lohnsklaven bei der Stange hält und verdeckt, dass man mit dem, den man da aktiv oder passiv verfolgt, ziemlich viel gemeinsam hat und dass ein gemeinsamer solidarischer Kampf gegen die herrschende Ordnung dem Menschsein viel näher käme als die projektive Abwehr im Rassismus, die nur darauf abzielen kann, das Elend auf Dauer zu stellen.
Den Antisemitismus als einen spezifischen Rassismus zu verstehen, der sich eben gegen die Juden richtet, greift zu kurz. Auch wenn nicht geleugnet werden kann, dass es durchaus rassistisch begründeten Antisemitismus gegeben hat, ist diese Begründung keine für den modernen Antisemitismus wesentliche. Die Juden, das haben Adorno und Horkheimer dargelegt, sind in der Ideologie der Faschisten nicht als weitere Rasse wie jene zu verstehen, die die dargestellte Integration des gesellschaftlich-produziert überfüssigen Subjekts leisten sollen, sondern sie sind die Gegenrasse:
„Für die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches; von ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. […] Die Juden sind heute die Gruppe, die praktisch wie theoretisch den Vernichtungswillen auf sich zieht, den die falsche gesellschaftliche Ordnung aus sich heraus produziert. [...] Während es der Herrschaft ökonomisch nicht mehr bedürfte, werden die Juden als deren absolutes Objekt bestimmt, mit dem bloß noch verfahren werden soll. Den Arbeitern, auf die es zuletzt freilich abgesehen ist, sagt es aus guten Gründen keiner ins Gesicht; die Neger will man dort halten, wo sie hingehören, von den Juden aber soll die Erde gereinigt werden, und im Herzen aller prospektiven Faschisten aller Länder findet der Ruf, sie wie Ungeziefer zu vertilgen, Widerhall. Im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüste ist ausschließlicher Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen, um jeden Preis.“
Was sich in den Eigenschaften, die die Antisemiten den Juden quasi als „Übermenschen“ zuschreiben (enorme Macht, Gerissenheit, Subversion, sippenhafter Zusammenhalt, etc.) und denen, wie beim Rassismus, keine tatsächliche Struktur in der Realität entspricht, ausspricht, ist doch etwas Wirkliches, nämlich die Projektion der Antisemiten: „Im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drücken sie ihr eigenes Wesen aus.“ Die Juden mussten eben das ganz andere zur deutschen Volksgemeinschaft verkörpern, an ihnen definierten die Deutschen in ihren Nürnberger Rassegesetzen quasi ex negativo, was deutsch ist. Und dieses Abgespaltene, was die Juden verkörpern mussten und was mit ihnen vernichtet werden sollte, entlarvte sich in der Politik der Nazis als ein Verdrängtes und insgeheim Gewünschtes. Schließlich verfolgten die Nazis am Ende jene Weltherrschaftspläne, die sie den Juden nachsagten.
Im Gegensatz zum Rassismus ist der Antisemitismus also alles andere als eine unkonkrete Abneigung gegen das Fremde, sondern die spezifische Furcht vor jener Gegenrasse, die das Unverständliche, Geheimnisvolle, kurz: das Abstrakte kapitalistischer Vergesellschaftungsdynamik zu verkörpern hatte, also jenen gesellschaftlichen Bereich an dem der Waren- und Geldfetisch sein Geheimnis hat, die Zirkulationssphäre. Gerade jener Bereich, der zwischen Produktion und Konsumtion tritt und über den die Austauschbeziehungen geregelt werden, wird mit den Juden assoziiert. Und hierin sucht der Antisemit die Negativfolgen der herrschenden Vergesellschaftungsweise und jene, die für sie Verantwortung tragen sollen.
Der moderne Antisemitismus kommt heute weitgehend ohne die Juden als unmittelbares Feindbild aus, genauso wie es kaum noch Menschen gibt, die sich als Antisemiten bezeichnen würden. Der latente Antisemitismus der bürgerlichen Gesellschaft besteht weiter, er musste sich nach Auschwitz neue Formen suchen, aber als gesellschaftliches Verhältnis verschwindet er erst mit der Gesellschaft, die ihn hervorbringt.
Heutige Formen des Antisemitismus nach Auschwitz, die mit subtilerer Judenfeindschaft hantieren, bezeichnet man als sekundären Antisemitismus. Beispiele wären die Relativierung der NS-Verbrechen durch den Vergleich mit anderen Genoziden oder den Verbrechen des Stalinismus, der Vorwurf, die Juden betrieben mit der Opferrolle eine Art „Holocaust-Industrie“, mit der man sich weltweit Vorteile verschaffe oder etwa der Schuldabwehr-Antisemitismus, der dem jüdischen Staat Israel gewissermaßen die Verteidigung gegen seine Feinde zur Last legt und am Umgang Israels mit seinen Gegnern mittels NS-Vergleichen nazistische Methodiken aufzudecken meint. Dieser Schuldabwehr-Antisemitismus speist sich aus Gefühlen der Scham und der namensgebenden Abwehr des Eingeständnisses der Schuld der eigenen Nation an den begangenen Verbrechen, mit der man sich trotz derer so gerne identifizieren möchte und die ja am Ende so schlimm nicht sein können, wenn Israel sie unablässig an den Palästinensern wiederholt. Hier geht der Schuldabwehr-Antisemitismus nahtlos über in seine heute bedrohlichste Gestalt für die Existenz des jüdischen Staates und seiner Bewohner: den Antizionismus. Der Wunsch nach Vernichtung des jüdischen Staates beseelt nicht nur deutsche Faschisten, sondern eine vom iranischen Regime und anderen Islamisten angeführte antizionistische Internationale, weshalb die Antifa Suhl/Zella-Mehlis an anderer Stelle völlig zutreffend resümierte: „Die Solidarität mit Israel, mit dem Staatszweck des Zionismus, ist deswegen für Antifaschisten das Gebot der Stunde, ganz egal welche Regierung in Tel Aviv die Geschicke des Landes bestimmt.“1
Eine weitere, mehr noch als die zuvor genannten, auch in der politischen Linken grassierende Form des Antisemitismus ist der strukturelle Antisemitismus. Er macht sich an diversen Ausprägungen der auch von vermeintlichen Linken vertretenen Banken-Kritik bemerkbar und wird, aufgrund seiner Ähnlichkeit zur bereits angesprochenen antisemitischen Argumentationsweise, die den Juden die Schuld an den Verfehlungen des undurchschauten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems nachsagen will und in ihnen deren negative Folgen personalisieren will, als struktureller Antisemitismus bezeichnet. Zentral ist hier die Unterscheidung zwischen dem sogenannten produktiven Kapital der Arbeit und dem sogenannten raffenden Kapital des Wuchers bzw. dem Finanzkapital. Letzteres wird dabei gerne mit seinen Repräsentanten identifiziert, weswegen man in diesem Zusammenhang auch von personalisierter Kapitalismuskritik spricht. Verloren geht dabei die Einsicht, dass das eine (kapitalistische Produktion) nicht ohne das andere (Kredit) wäre. Für die populistische Kritik an Banken oder vermeintlich am Kapitalismus überhaupt bedeutet das, dass hier die komplexe kapitalistische Verwertungslogik zusammengekürzt und auf die Gier oder doch zumindest auf moralisch bedenkliches Handeln einzelner ökonomischer Akteure reduziert wird. Dabei trägt das verantwortungslose Handeln einzelner – das es durchaus geben mag, aber eben als Rolle in einem gesellschaftlichen Verhältnis, in dem zu Bestehen Verantwortungslosigkeit voraussetzt – kaum mehr zum Erhalt der den Hunger produzierenden Ordnung bei als der gemeine Student, der sich ausbilden lässt, oder der gemeine Arbeiter, der arbeitet. Sie alle tragen innerhalb des Rahmens dieser Vergesellschaftungsweise als Funktionsträger, Marx nannte es Charaktermasken, ihren Anteil am Fortbestehen dieser Ordnung, die einfach nicht menschenfreundlich, nicht vernünftig und nicht domestizierbar ist, aber eines ganz sicher: nämlich innerhalb ihrer Gesetzmäßigkeiten, ihrer formalen Bestimmtheit logisch bzw. zwingend.
So liegt der Ursprung antisemitischen Denkens, wie der des rassistischen, in der bürgerlichen Subjektivität selbst, die sich, so Joachim Bruhn, „als Selbstbewusstsein der Ware und daher im Kampf um die Realisierung ihres Werts“ konstituiert, also in der Unterordnung unter ein undurchschautes, wie entmündigendes Verhältnis. Wenn die Identität des Bürgers nicht an sich selbst besteht, sondern an das reibungslose Funktionieren des Marktes und die Abgrenzung von Anderen geknüpft ist, dann bedeutet jede Krise der Marktwirtschaft den möglichen Identitätsverlust; mit jeder Krise kommt die panische Angst vor der Entwertung zum Durchbruch. In dieser Krisen-induzierten Panik drohenden Identitätsverlustes fahndet das Subjekt, das Subjekt bleiben will, nach etwas, das die Implosion bürgerlicher Subjektivität noch aufhalten kann. Und an diesem Punkt verschafft sich der zuvor latente Antisemitismus in der Wirklichkeit manifest Geltung, indem mit der Vernichtung der Juden, das an sich nichtige, weil auf seine gesellschaftliche Funktion reduzierte und deswegen objektiv überflüssige, Selbst kuriert werden soll. Die Gemeinschaft der qua Blut- und Bodenideologie Gleichen flüchtet in die Vorwärtsverteidigung und zieht „die letzte Konsequenz aus der bürgerlichen Gleichheit durch kapitalistische Vergleichung“ (Bruhn), die, so Adorno, in der formalen Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft immer schon schwelte:
„Der Völkermord ist die absolute Integration, die überall sich vorbereitet, wo Menschen gleichgemacht werden […], bis man sie, Abweichungen vom Begriff ihrer vollkommenen Nichtigkeit, buchstäblich austilgt. [...] Was die Sadisten im Lager ihren Opfern ansagten: morgen wirst du als Rauch aus diesem Schornstein in den Himmel dich schlängeln, nennt die Gleichgültigkeit des Lebens jedes Einzelnen, auf welche Geschichte sich hinbewegt: schon in seiner formalen Freiheit ist er so fungibel und ersetzbar wie dann unter den Tritten der Liquidatoren.“
Hier bricht sich also Bahn, was Horkheimer und Adorno, als „Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen“ bezeichneten: die nazistische Transformation der bürgerlichen Klasse in die germanische Rasse konkretisiert sich als Vernichtungswut gegen Über- und Unmenschen.
Im gesellschaftlichen Verhältnis des Antisemitismus wie im Rassismus versucht sich also das politökonomisch konstituierte Subjekt von seiner gesellschaftlich-produzierten Überflüssigkeit zu befreien, ohne diese zu begreifen und ohne sie aufheben zu können. Vielmehr sind Antisemitismus wie Rassismus Teil des Rechtfertigungskosmos der bestehenden Ordnung selbst durch dessen Krise hindurch. Sie helfen, die kapitalistische Herrschaft bis zu ihrer falschen Aufhebung zu reproduzieren, ohne an ihrer Widersprüchlichkeit zu verzweifeln. Sie sind, auch das wird in der Analyse als gesellschaftliche Verhältnisse klar, aus dieser Gesellschaftsordnung nicht wegzudenken. Sie sind auch nicht durch Erwachsenenbildung, Menschenrechte oder Sozialarbeit zu beseitigen, sondern nur mit der Ordnung, die sie notwendig hervorbringt und für deren Beseitigung es unzählige gute Gründe gibt. Deswegen geht es Antifa nicht um schärfere Gesetze oder eine bessere Politik. Politik, insbesondere das was in dieser Gesellschaft oft darunter verstanden wird, etwa Parteipolitik, hat als Referenzpunkt immer den Staat und das Recht. Aber Staat und Recht sind keine Institutionen, mit denen sich grundlegende gesellschaftliche Verhältnisse reformieren bzw. ändern lassen, sie sind vielmehr selber bloß der Ausdruck solcher Verhältnisse. Was daher einer radikalen Linken viel näher käme, wäre die Entwicklung eines Konzepts von Anti-Politik, eine Kritik der Politik, des Staats und des Rechts als Institutionen der gesellschaftlichen Menschenfeindlichkeit.
Dass aber nun ein Programm der Abschaffungen, der Aufhebung der kapitalistischen Vergesellschaftungsweise, also der Kommunismus, nicht so einfach werden wird, weil ausgerechnet in Zeiten der Krise der Kapitalakkumulation nicht die kommunistische Revolution das den Menschen Naheliegendste ist, ist angesichts des Zustandes der Welt offensichtlich. Über die vielfältigen Gründe dieses Dilemmas und über die Frage der Praxis – Was tun? – kommen wir in der folgenden Ausgabe der Alerta Südthüringen in unserem dritten Teil der „Was heißt Antifa?“-Reihe zu sprechen.