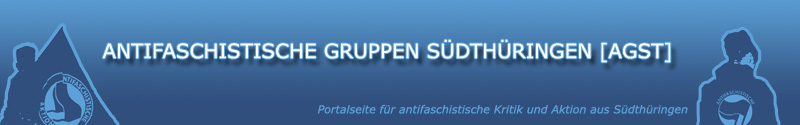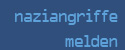



Für aktuelle News checkt bitte unseren neuen Blog!
Suhl: 23. Antifaschistischer/Antirassistischer Ratschlag – ein Fazit
Zum 23. Mal in Folge öffnete der antifaschistische und antirassistische Ratschlag in Thüringen am 1. und 2. November 2013 seine Türen, um Vernetzung, Diskussion und Öffentlichkeit für gesellschaftlich vielfach marginalisierte Themen zu ermöglichen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte fand die Veranstaltung nun im Südthüringischen Suhl statt. Ein kleines, spätes Fazit.
Nazis – offene Anfeindungen und unheimliche Ruhe
Der Ratschlag begann wie in vielen Jahren zuvor bereits am Freitagabend mit einem antifaschistischen Mahngang. Etwa 50 Antifaschist_innen beteiligten sich an der Aktion, die durch die Innenstadt an zahlreichen Orten faschistischer Verfolgung und antifaschistischen Widerstands vorbeiführte. Während der Demonstration kam es zwei Mal kurz nacheinander zu gefährlichen Konfrontationen mit Nazis und einer Gruppe rechtsoffener Leute, die in der Innenstadt Alkohol tranken. Am Suhler Waffenmuseum in der Friedrich-König-Straße beschimpfte eine Gruppe junger Nazis die Teilnehmer_innen des Mahngangs und warf eine noch nicht geleerte Prosecco-Dose in die Menge. Das Wurfgeschoss schlug knapp neben einem Teilnehmer auf dem Boden auf. Hätten die Nazis getroffen, wäre der Abend für die Person wohl im Krankenhaus geendet. Weniger Meter weiter in der Friedrich-König-Straße empfing ein aufgebrachter Mob aus rechtsoffenen und alkoholisierten Personen die Demonstrierenden mit Sätzen wie „Brennt, ihr Juden“ und „Antifa, ha ha ha“.
Ohne weitere Probleme endete der Mahngang an der Jugendschmiede, wo die „Bavarian Taliban“ ihr Projekt, eine Art satirisches Kabarett, vorstellten. Auch am nächsten Tag waren keine weiteren Aktivitäten von Nazis zu vernehmen. Zwar vermeldete das Nazi-Infoportal aus Suhl/Zella-Mehlis, dass 35 Nazis auf dem Weg zum Ratschlag von der Polizei aufgehalten worden seien, wie viel an dieser Story allerdings dran ist, ist fraglich. Die Polizei war an diesem Tag nicht mit einem so großen Aufgebot in Suhl vertreten, um 35 Nazis stoppen zu können. Alles in allem und angesichts vorheriger Angriffe auf antifaschistische Veranstaltungen in Südthüringen war es eine durchaus unheimliche Ruhe, die den Tag umgab.
Ratschlag – Debatte und Vernetzung
Der diesjährige Ratschlag mit seinen zahlreichen Workshops, Seminaren und Vorträgen begann in der Aula des Suhler Gymnasiums, wo auf dem Podium ein Genosse der Antifa Suhl/Zella-Mehlis, Uli Töpfer für das Bündnis gegen Rechts in Meiningen und Michael Ebenau von der IG Metall in Jena über die Möglichkeiten und Perspektiven antifaschistischer Praxis diskutierten. Die Debatte begann mit Input-Statements und wurde dann fürs Auditorium geöffnet. Diskutiert wurden Reibungspunkte im Praxisverständnis und der bündnispolitischen Ausrichtung der jeweiligen Ansätze. Unseren ausformulierten Diskussionsbeitrag dokumentieren wir im Anschluss an diesen Kurzbericht. An unserem Workshop zum Thema „Was heißt Antifa?“ beteiligten sich ca. 30 Antifaschist_innen, um über das Verständnis antifaschistischer Theorie und Praxis ins Gespräch zu kommen. Insgesamt besuchten ca. 200 Menschen den diesjährigen Ratschlag und damit so viele wie seit Jahren nicht mehr. Dabei wurde der Ratschlag nicht nur für Debatten und Standortdiskussionen genutzt, sondern auch für die Vernetzung politischer Gruppen und Organisationen. Wo der Ratschlag im nächsten Jahr stattfindet, steht noch nicht fest.
Fazit des Fazits
Alles in allem fällt es uns schwer handfeste Ergebnisse aus den Vorbereitungen und der Durchführung des Ratschlags zu präsentieren. Positiv bleibt sicher, dass der diesjährige Ratschlag wieder mehr im Zeichen der Debatte stand, dass wieder offener und konfrontativer Brüche zwischen den Selbstverständnissen und Praxen antifaschistischer Gruppen und Initiativen diskutiert wurden. Ob das im Nachhinein zur Verschiebung von Positionen, zur Radikalisierung antifaschistischer Kritik führt, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht feststellen. Negativ zurück bleibt – wie so oft – der Eindruck, dass theoretische Auseinandersetzungen in der politischen Linken häufig auf Befremden und Abwehr stoßen und dass Positionen, die den Kampf gegen Nazis zum Kampf gegen die, die Nazis hervorbringende, Gesellschaftsordnung radikalisieren wollen; Positionen, die Rassismus und Antisemitismus als notwendig von dieser Gesellschaft hervorgebrachte Verhältnisse analysieren und kritisieren, von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Akteuren vielfach nicht mehr nachvollzogen oder einfach nicht ernst genommen werden. Merklich häufig daran, dass, wenn es um radikale antifaschistische Gesellschaftskritik geht, die Rede von der Gewaltlosigkeit erhoben wird, wohl, weil die Kritik der Gesellschaft als Aufruf zur Gewalt gegen ihre Nazis missverstanden wird. Die Aufgabe, die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse (auch in der Breite der Gesellschaft) voranzutreiben, sie als Bedingung für den nachhaltigen Kampf gegen Nazis (und rassistischen und antisemitischen Hass) begreifbar zu machen, bleibt eine Aufgabe, vor der wir immer wieder scheitern werden und die wir immer wieder aufs Neue versuchen müssen, weil es ohne die Aufhebung der bestehenden Gesellschaft keine freie Assoziation geben wird und keinen Zustand, wo jeder ohne Angst verschieden sein darf.


Beitrag der Antifa Suhl/Zella-Mehlis zum Auftaktpodium des 23. Antifaschistischen/Antirassistischen Ratschlags
Im Aufruf des diesjährigen Ratschlags haben wir die unseres Erachtens nach maßgebliche Differenz zwischen zivilgesellschaftlichen Anti-Nazi-Aktivisten und der linksradikalen Antifa, nach zähen Diskussionen, ob man Differenzen in einen gemeinsamen Aufruf aufnehmen könnte, festgehalten. Dieser gemeinsame Aufruf enthält überhaupt weitgehende gesellschaftskritische Positionen, so dass man sich schon fragen muss, warum ihn bestimmte sozialdemokratische Milieus unterstützen und wenn sie ihn denn unterstützen, weil sie die Kritik teilen, warum sie denn nun ihre Politik nicht ändern.
Aber zurück zum Thema. Im diesjährigen Aufruf des Ratschlags schreiben wir also bezüglich der angesprochenen Differenzen: „Der Ratschlag will als Ort für Diskussion zur offenen Auseinandersetzung zwischen denen beitragen, die pluralistisch orientiert, sich um gesellschaftliche Breite bemühen und ihren Fokus auf die Verhinderung von Naziaufmärschen sowie die Aufklärung der Bevölkerung legen wie denen, die Rassismus und Antisemitismus als gesellschaftliche Verhältnisse, als notwendige Erscheinungen in einer kapitalistischen Gesellschaft begreifen, die Aktionsformen, die diese Ordnung reproduzieren ablehnen und in der Abschaffung jenes kapitalen Verhältnisses die Lösung sehen.“
Was heißt das nun? Warum sprechen Antifa-Gruppen, wie unsere, von Rassismus und Antisemitismus als gesellschaftlichen Verhältnissen, als notwendigen Erscheinungen einer kapitalistischen Gesellschaft? Meine Ausführungen dazu werden gezwungenermaßen kurz und knapp sein. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auf unseren, an diese Podiumsdiskussion anschließenden Workshop verweisen, wo wir dieses Thema aufgreifen und vertiefen werden.
Was wir damit
nicht meinen, wenn wir von Rassismus und Antisemitismus als gesellschaftlichen Verhältnissen reden, ist die in der Zivilgesellschaft inzwischen weit verbreitete Ansicht, dass Rassismus und Antisemitismus vielleicht gesellschaftliche Verhältnisse seien, weil sie in der Mehrheitsbevölkerung weit verbreitet sind. Bestandteile dieser Ideologien sind ja in weiten Bereichen der Gesellschaft Common Sense. Das zeigt sich etwa in der deutschen Flüchtlingspolitik oder in der rassistischen Einteilung von Geflüchteten in politische Flüchtlinge und sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Die Erklärung, warum wir Rassismus und Antisemitismus als gesellschaftliche Verhältnisse begreifen wollen, geht einen Schritt hinter die Tatsache ihrer gesellschaftsweiten Verbreitung zurück; sie geht auf den Grund, erklärt im besten Fall, die gesellschaftlichen-notwendigen Entstehungsbedingungen von Rassismus und Antisemitismus.Mit der weltweit durchgesetzten kapitalistischen Vergesellschaftungsweise und einer von Konkurrenz- und Profitstreben durchdrungenen Gesellschaft, hat sich auch, gewissermaßen als ihre Reflexionsform, eine Ideologie entwickelt, die die bestehende Herrschaft rechtfertigt und zur ihrer Reproduktion beiträgt. Teil dieser bürgerlichen Ideologie sind der Rassismus und der Antisemitismus. Sie sind keine Irrungen von Einzelnen oder etwa eine Erkrankung des Bewusstseins, der durch Sozialarbeit, Menschenrechte und Erziehung beizukommen wäre, sondern sie sind aus der politökonomischen Konstitution bürgerlicher Subjektivität erklärbar. Der Rassismus wie der Antisemitismus in ihren manifesten Formen sind als Reaktionen der Gesellschaft auf die gesellschaftlich-produzierte Überflüssigkeit der Einzelnen zu erklären. Rassismus wie Antisemitismus reagieren auf die Tatsache, dass die Einzelnen für das wesentliche Bewegungsgesetz der Gesellschaft austauschbare und tendenziell – mit steigender Rationalisierung, Maschinisierung, Effektivierung, etc. – überflüssige Momente eines Ganzen sind, das nicht dazu da ist ihre Bedürfnisse zu erfüllen oder sich von ihnen vernünftig einrichten zu lassen. Das Wissen der Einzelnen um die eigene Austauschbarkeit und Überflüssigkeit für die gesellschaftliche Reproduktion bricht sich Bahn in der Angst im endlosen kapitalistischen Dynamisierungsprozess abgehängt zu werden, seinen Job bzw. sein Auskommen zu verlieren und zu dem zu werden, was man tendenziell schon ist aber nicht sein will: Objekt – Objekt von Staatsaktionen, von Armenfürsorge, Objekt des Arbeitsamtes oder der Polizei. Um sich nun vor der Einsicht in die eigene Überflüssigkeit für die bestehende Ordnung zu schützen, flüchtet sich das Subjekt, das Subjekt bleiben will, in ideologische Welterklärungen, mit denen es seiner Existenz Sinn gibt; sich diese Existenz aufwertet, indem man andere abwertet.
Die Kritik des Rassismus wie des Antisemitismus muss diese als gesellschaftliche Verhältnisse begreifen, also als Produkte der materiellen gesellschaftlichen Ordnung, in denen sie entstehen und in denen sie eine wichtige Funktion zur Rechtfertigung und zum Erhalt jener Ordnung einnehmen. Sie muss sie als gesellschaftliche Verhältnisse begreifen, weil das gesellschaftlich produzierte bürgerliche Subjekt, also der in dieser Gesellschaft sich bewegende Einzelne, seine Identität nicht an sich selbst gewinnt, sondern u.a. in der Abgrenzung von anderen, mit denen es sich in einem ständigen Konkurrenzverhältnis begreifen muss. Jenes Subjekt findet Identität, um es mit dem hier anwesenden und die zweite Workshop-Phase bereichernden Joachim Bruhn auf den Punkt zu bringen, „im Prozeß einer ständigen Abgrenzung und eines permanenten Zweifrontenkrieges gegen das 'unwerte' und gegen das 'überwertige' Leben.“ Mit anderen Worten: in der rassistischen und/oder antisemitischen Abgrenzung. Keine Bestandteile sind so zentral für Naziideologie wie Rassismus und Antisemitismus und beide haben ihren Ursprung in der Grundform jener Ideologie, der bürgerlichen Ideologie; der Ideologie, die für diese Gesellschaft konstituierend ist, mit der jede und jeder von Geburt an konfrontiert ist und die sich ins Subjekt einschreibt, ob man denn nun will oder nicht. Diese Ideologie des Rassismus wie des Antisemitismus missversteht der bürgerliche Antifaschismus oder der Staatsantifaschismus, der mittlerweile zum Bestandteil der staatlich verordneten politischen Kultur in diesem Land geworden ist, als Vorurteil, als Erkrankung des Bewusstsein, dem durch Information über die Schlechtigkeit dieses Denkens beizukommen wäre. In diesem Punkt und freilich nicht nur in diesem, unterscheidet sich unsere Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse ganz fundamental von dem Praxisverständnis der politischen Linken, die ich als sozialdemokratische oder reformistische Linke bezeichne und von der ich eine radikal-gesellschaftskritische Linke unterscheiden würde. Wer Rassismus und Antisemitismus als notwendigen Teil der gesellschaftlichen Totalität, also als Teil der bestehenden kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse, die sich unweigerlich in die Einzelnen einschreiben, versteht, dem kann es nicht bzw. nicht ausschließlich um bessere Gesetze, um Verbote oder ähnliches gehen, sondern eben um die Abschaffung dieser Verhältnisse.
Was heißt das also in aller Kürze für antifaschistische Praxis und die bündnispolitische Ausrichtung der linksradikalen Antifa? Zunächst einmal heißt das
nicht , dass antifaschistische Praxis ihr Heil ausschließlich in der Isolation suchen sollte. Sie muss breite Bündnisse eingehen wo diese Sinn machen, wo Geflüchteten, Migranten und Linken eh das Wasser bis zum Hals steht, wo sich Pogrome andeuten oder gar das Umkippen der sachlich-vermittelten gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse in faschistische Gewaltverhältnisse. Dort muss die Antifa das bestehende Schlimme gegen das Schlimmere verteidigen. Wo das nicht der Fall ist, wo die Verhältnisse stagnieren, muss sie sich die Zeit nehmen, um am theoretischen Verständnis dieser Gesellschaft zu arbeiten, ihren Gegenstand begreifen lernen. Sie muss schließlich die Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse vorantreiben, in der Hoffnung kritisches Bewusstsein zuerst bei sich selbst und sodann bei vielen Einzelnen zu schaffen.Die Antifa tritt des Weiteren – etwa in den Bereichen der Flüchtlings-, Antirepressions-, „Freiraum“- und natürlich Anti-Nazi-Arbeit – für die Verbesserung von Lebens- und „Kampfbedingungen“ im Bestehenden ein, allerdings in einer Weise, die sich der eigenen Ohnmacht, der Beschränktheit solchen Handelns bewusst macht und die dieses Bewusstsein zu verbreiten sucht. Antifa bedeutet
nicht die Anleitung zu blinder antikapitalistischer Praxis, was auch immer das sein mag. Sie verfolgt eine theoretisch-reflektierte Praxis, die Sinn und Zweck ihrer Aktionen am abzuschaffenden Gegenstand bemisst und die nicht aus den Augen verlieren darf, dass es Schlimmeres gibt als die bestehende Gesellschaft: Dass Antifa im Sinne des Adornoschen Kategorischen Imperativs alles dafür tun muss, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, dass nichts ähnliches geschehe. Insofern ist Antifa eine widersprüchliche Angelegenheit, was ihren praktischen Horizont angeht: Sie verfolgt eine Theorie, die auf Abschaffung der bestehenden Herrschaftsverhältnisse zielt und muss sich gleichzeitig bewusst machen, dass diese Abschaffung heute nicht ansteht, dass es vielmehr darum geht, Schlimmeres zu verhindern, ohne dabei zu vergessen, dass – ganz abstrakt gesagt – jenes zu verhindernde Schlechtere Produkt des bestehenden schlechten Zustands ist.Bündnispolitisch bedeutet das also weiterhin, dass die Antifa Bündnisse meiden muss, wo all das nicht mehr Ziel und Zweck ist, sondern Politik für den jeweiligen Standort, für die euphemisierende Darstellung dieser Gesellschaft als offen und tolerant, als friedlich und freiheitlich betrieben wird. All dies ist sie nämlich nicht. Wir wollen nicht den Standort Deutschland vor seinen Nazis verteidigen, sondern die Naziproblematik auf ihre bürgerlichen Bedingungen zurückführen, deshalb schließe ich mit einem Zitat aus einem Redebeitrag der Antifa Arnstadt von 2010, dessen Nachdruck übrigens in der frisch erschienenen Alerta Suhl/Zella-Mehlis gelesen werden kann, die an unserem Infostand zu haben ist. Dort heißt es also:
Die Antifa muss Bündnisse aufkündigen, in denen ein gesellschaftskritischer Standpunkt nicht vertreten werden kann oder dort, wo er untergeht. Sie muss, anstatt sich an Nazi-Events abzuarbeiten, die radikale Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse vorantreiben, in der Hoffnung zur kritischen Bewusstseinsbildung vieler Einzelner beizutragen. Für Bündnispolitik heißt das, sich Bündnisse zu suchen, in denen die Mitglieder auf inhaltliche Kritik nicht narzisstisch gekränkt reagieren, sondern sie als Chance zur Reflexion des eigenen Standpunktes wahrnehmen. [...] Die Veränderung des Ganzen erfordert immer auch die Emanzipation der Einzelnen von den Anforderungen einer von Konkurrenz und Profitstreben durchdrungenen Gesellschaft. Wer diese Zurichtungsmaschinerie zerstören will, muss sie erstmal verstehen lernen. Dazu gehört es, zu begreifen, dass Nazievents vielleicht geeignete Anlässe sind radikale Gesellschaftskritik zu betreiben, dass aber etwas gewaltig schief läuft, wenn die Verhinderung dieser Aufläufe zum einzigen Ziel, zum Selbstzweck, verkommt.