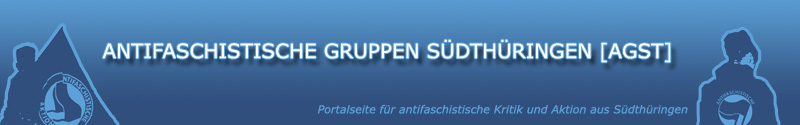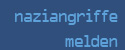



Für aktuelle News checkt bitte unseren neuen Blog!
Debattenbeitrag: Über bürgerliche Vorurteile und die blinde Wut des Machens
In der [Lirabelle], einer jungen Erfurter Zeitschrift ist uns jüngst vorgeworfen worden, wir betrieben Kritik in Form von leeren Abstraktionen und würden unsere Theorie nicht auf die empirische Wirklichkeit rückvermitteln. In der nun erschienen neuen Ausgabe der Zeitschrift haben wir unsere Antwort, die wir hier nun dokumentieren, veröffentlicht. In die gleiche Debatte und in ganz ähnlicher Weise intervenierten die Autoren Simon Rubaschow und Ox Y. Moron. Auch deren Beiträge wollen wir an dieser Stelle dokumentieren.
Über bürgerliche Vorurteile und die blinde Wut des Machens
Die Antifa Arnstadt-Ilmenau verteidigt sich gegen eine unkritische Kritik, die geschichtsvergessen und unaufgeklärt zu revolutionären Experimenten anleitet.In der ersten Ausgabe der neu erschienenen Erfurter Zeitschrift Lirabelle setzten sich die drei Texte von Karl Meyerbeer1, Peter Gispert2 und Lukas3 u.a. mit unserem Redebeitrag zur Notwendigkeit kategorialer Gesellschaftskritik4, gehalten auf der „Frust“-Demo am 13. November 2012 in Erfurt, auseinander, um sogleich den Beweis des Gegenteils für die von Lukas getätigte Aussage, aus unseren Interventionen entspringe keine Debatte, anzutreten. Dieser Text ist eine Antwort.
Der Unterschied zwischen den Texten von Meyerbeer und Lukas liegt v.a. darin, dass der erste in hemdsärmeliger, fast schon antiintellektualistischer Weise vorträgt, wo sich letzterer aufdringlich um Tiefsinn bemüht, der, wie so häufig, in eine Bleiwüste ungekannten Ausmaßes mündet – was, nebenbei gesagt, bemerkenswert ist für jemand, der unsere Kritik als langweilig abtut. Meyerbeer gibt also den schreibenden Prolet, der als besserer Besserwisser aus erster Hand weiß, wie die Proletarier über die besserwisserische Theorie denken, Lukas den proletenfreundlichen Akademiker, den „organischen Intellektuellen“, wie das in bestimmten Fraktionen des linken Sektenwesens heißt. Inhaltlich gehen beide Texte in dieselbe Richtung. Sie kritisieren unsere Kritik (und die von Eva Felidae5) als leere Abstraktion, die sich konkreten Ansagen verweigert, Theorie auf die Struktur der Gesellschaft verkürzt, ohne sie auf die empirische Wirklichkeit rückzuvermitteln bzw. vermeintlich dialektisch aus ihr hervorzugehen. Meyerbeer lässt aus guten Gründen jeden Verweis auf die aktuellen Referenztexte weg, seine Argumentation würde sich daran zerschlagen, Lukas versucht näher an den inkriminierten Texten zu argumentieren. Peter Gispert zieht aus dem von Lukas und Meyerbeer gesagten gewissermaßen die politischen Konsequenzen, leitet zu einer Praxis an, zu der die Theorie bestenfalls die Zuarbeit zu liefern hat.
Aufklärung und Aufhebung
Lukas ist es zunächst wichtig, auf einen Widerspruch in unserer Argumentation hinzuweisen, der – und Lukas müsste das wissen – kein solcher ist. Der „heillose Widerspruch“ (Lukas) bestehe darin, (bürgerliche) Aufklärung zu kritisieren und selber welche (radikale) betreiben zu wollen. Bei Lukas ist Aufklärung gleich Aufklärung. Dabei besteht der Unterschied zwischen der Aufklärungspraxis beispielsweise des Staatsantifaschismus von Mobit, NDC und Co. zu dem radikalem Verständnis von antifaschistischer Aufklärung darin, dass erstere durch Information über Vorurteile, Nicht-Wissen etc. aufklären, dem Mob also Manieren beibringen will. Der Aufklärung im radikalen Verständnis hingegen geht es um gesellschaftlich-unbewusste Bestimmungen der gesellschaftlichen und individuellen Konstitution, um die sich hinter den Rücken der Menschen verselbständigenden Formbestimmungen des gesellschaftlichen Verkehrs: „Gerade weil ein Unbewußtes nicht einfach ein Nicht-Wissen ist, dem durch Wissen abzuhelfen wäre, sondern weil Unbewußtes eine dem bewußten Subjekt nicht verfügbare und es doch in seinem Denken und Handeln bestimmende Rationalität ist, ist Aufklärung nicht durch Information zu leisten, sondern durch Reflexion.“ (Gerhard Stapelfeldt)
Zwischen der Aufklärung im ersten und der im letzten Verständnis liegt ein Unterschied ums Ganze. Aufklärung als Reflexion, wie sie auch von unserer Genossin Eva Felidae gedacht ist, ist kein leeres Gedankending, wie Lukas das möchte, kein „Ergebnis einer reinen Reflexionstätigkeit“, sondern setzt an materiellen, leiblichen Gegebenheiten an. Sie setzt am Leiden der Einzelnen, an erfahrenen Widersprüchen und Missverhältnissen an, klärt über den gewalttätigen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse auf, die diese Leiden produzieren. Sie will den Schleier des Verblendungszusammenhanges, der sich vor die wirklichen Verhältnisse geschoben hat, lüften und helles, waches Bewusstsein ermöglichen. Sie ist daher keine „Agitation oder Propaganda“, wie Lukas meint, weil es ihr nicht um äußere Zustimmung, um Manipulation des Bewusstseins geht, sondern darum, das Begreifen der gesellschaftlich-notwendigen Zurichtung jedes Einzelnen zu ermöglichen.
Mit der Kritik am vermeintlichen Widerspruch, Aufklärung zu kritisieren und zu betreiben, verwischt Lukas, dass die Frage der Praxis implizit beantwortet ist: Praxis, als aufhebende, revolutionäre verstanden, steht nicht auf dem Programm. Insofern hat Lukas einen wichtigen Punkt gemacht: aufhebende Theorie ist unterm Bann der Verhältnisse nicht mit aufhebender Praxis in Deckung zu bringen. Das ist längst keine Absage an Praxis überhaupt, aber an die Vorstellung, dass die gegebenen Verhältnisse eine solche hergeben, die die Verhältnisse aufhebt. Denn gerade weil Praxis derzeit nicht in der Lage ist, die gesellschaftlichen Widersprüche aufzuheben, ebnet die blinde Praxis, die auf ihre Ohnmacht nicht reflektiert, die Widersprüche ein, indem sie über sie hinweg geht. Praxis muss heute einen Schritt zurück gehen. Sie muss auf die Bedingungen reflektieren, die sie unmöglich machen. Den Widerspruch, dass kommunistische, also aufhebende Praxis objektiv verstellt und trotzdem dringend nötig ist, haben nicht die, die ihn benennen, in die Welt gesetzt, indem sie darauf reflektieren. Wir leben in nichtrevolutionären Zeiten, in Zeiten, in denen die radikale Linke mit überwältigender Ohnmacht geschlagen ist. Dass wir trotzdem an Praxis festhalten bzw. Praxis, die solche Ohnmacht nicht reflektiert, kritisieren, auch wenn wir sie nicht mit aufhebender Theorie in Deckung bringen können, weil die Verhältnisse keine aufhebende Praxis hergeben, ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch unserer Praxis statt einer in der Sache. Auf gesellschaftliche Emanzipation zielender Praxis muss es darum gehen, die Barrieren aus dem Weg zu räumen, die revolutionäre Praxis unmöglich machen: „Kritische Theorie ist aber kein Weg zu einem Plan, der verwirklicht werden muss, sondern Reflexion auf die Konstitutionsbedingungen der Hindernisse, die revolutionärer Praxis im Weg stehen.“ (JustIn Monday)
Was tun?
Das hat nie bedeutet, dass wir reformistische Praxis kategorial zurückgewiesen hätten, wo sie die Verbesserung von Lebensbedingungen bedeutete (z.B. Unterstützung von Flüchtlingskämpfen, Antirepressionsarbeit, „Freiraum“-Kämpfe, Zurückschlagen von Nazigewalt etc.). Wir haben das aber in dem Bewusstsein getan – und dieses Bewusstsein auch artikuliert – dass solche Praxis nicht die Lösung des strukturell bedingten Problems ist, dass solche Praxis nicht an die Ursache geht, sondern die Symptome bekämpft. Wer solche Praxis ablehnt und sich auf die große Theorie herausredet, rationalisiert, wie Horkheimer das einmal treffend formulierte, seine eigene Unmenschlichkeit. Uns ein solches Verhalten vorzuwerfen, ist abwegig. Wir haben uns auch nie besserwisserisch daneben gestellt und Weisheiten aus dem Elfenbeinturm verkündet, wie unsere unkritischen Kritiker das gern hätten, sondern wir haben versucht, in der mit dem Falschen verstrickten Praxis, der eigenen Ohnmacht gewahr zu werden, weil das der erste Schritt ihrer Überwindung ist. In der Konsequenz heißt das, bei Demos die Wahrheit über die Verhältnisse auf die Straße zu tragen, für sie einzutreten, ihr gegen die Übermacht der gesellschaftlichen Verblödung Geltung zu verschaffen, Maulwurfsarbeit zu betreiben. Das ist das, was unter den gegebenen Verhältnissen machbar ist.
Wer trotzdem an der Möglichkeit von revolutionärer Praxis festhält, weil die „objektiven Bedingungen einer revolutionären Umwälzung […] nach wie vor gegeben, erkennbar [sind]“ (Lukas) bzw. diese einen „Ansatz für Destabilisierung“ (Meyerbeer) bilden, der soll doch bitte vortreten und einen Vorschlag machen, denn entweder haben die unkritischen Kritiker Lukas und Meyerbeer den Masterplan schon auf Tasche und spannen uns auf die Folter oder sie betreiben Hochstapelei. Uns aber Absurditäten vorzuwerfen, wie, dass wir Phänomene auf ihre Struktur verkürzen, Brüche glattbügeln, Marxologie betreiben würden – aus guten Gründen ohne die Spur eines Belegs bei Meyerbeer – ist billig.6 Der Vulgärdialektiker Meyerbeer sieht die Lösung in der „dialektischen“ Vermittlung von Theorie und Praxis – in Wahrheit eher in der Indienstnahme der Theorie für die Praxis7, die viel eher dazu geeignet ist, über Brüche der gesellschaftlichen Konstitution hinweg zu gehen, als die Theorie, die innehält. Auch von einer kategorialen Kritik der Verhältnisse sofort den Vorschlag einer richtigen Praxis einzufordern, wie Lukas das tut, ist plump. Auf ähnlich penetrantes Drängen auf Vorschläge zur Praxis, reagierte einst Adorno wie folgt:
„Auf die Frage ‘Was soll man tun’ kann ich wirklich meist nur antworten: ‘Ich weiß es nicht’. Ich kann nur versuchen, rücksichtslos zu analysieren, was ist. Dabei wird mir vorgeworfen: Wenn du schon Kritik übst, dann bist du auch verpflichtet zu sagen, wie man’s besser machen soll. Und das allerdings halte ich für ein bürgerliches Vorurteil. Es hat sich unzählige Male in der Geschichte ereignet, daß gerade Werke, die rein theoretische Absichten verfolgen, das Bewußtsein und damit auch die gesellschaftliche Realität verändert haben.“Was sich bei Lukas, Gispert und Meyerbeer abzeichnet, ist keine theoretisch reflektierte Praxis, sondern eine Indienstnahme der Theorie zugunsten strategisch-praktischer Belange. Sie müsste tatsächlich so etwas wie eine Kontamination der Theorie zur Folge haben, weil sie den Bruch zwischen der aufhebenden und möglichen Theorie und der aufhebenden, aber unmöglichen Praxis überdeckt und erstere sich zweiterer unterzuordnen hätte. Die penetrante Nötigung zur Praxis, die sich in Äußerungen wie „wer alles will, der muss alles dafür tun“ (Lukas) ausdrücken, verstellen die Möglichkeit eines Innehaltens, eines Luftholens der Theorie und leiten an zur „blinden Wut des Machens“; sie korrespondieren mit der „Vorstellung vom fessellosen Tun, dem ununterbrochenen Zeugen, der pausbäckigen Unersättlichkeit, der Freiheit als Hochbetrieb“ (Adorno). Sie verlängern „die bisherige Geschichte, die immer eine von Herrschaft und Ausbeutung war und immer noch ist.“ (Eva Felidae) Sie können nicht in sie eingreifen, weil sie ihre Praxis – wo sie expliziert wird – gegen das kritisch-aufhebende Eingedenken der herrschenden Logik abdichten.
Geschichtslosigkeit und Unbekümmertheit
Was unter den gegebenen Verhältnissen zu tun bleibt, ist nicht die vergebliche Suche nach revolutionärer Praxis, sondern die Reflexion auf die Bedingungen, die solche Praxis derzeit und seit Jahrzehnten verstellen. Dabei gilt es nicht weniger für die Verhinderung des Schlimmsten wie für die Verbesserung der geringsten Lebensbedingungen einzutreten. Nicht umsonst hat Adorno den Marx’schen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, etc. dahingehend reformuliert, dass es nach Auschwitz und im Stande der Unfreiheit nun gelte, alles dafür zu tun, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, dass nichts ähnliches geschehe. Wer unter solchen Vorzeichen und in der ständig drohenden Gefahr einer negativen Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft fröhlich über revolutionäre Praxis daherreden will, der hat das nicht verstanden. Bei Lukas erscheint Auschwitz nicht als Möglichkeit der antisemitischen Rebellion gegen die bürgerliche Vergesellschaftung, ihre falsche Aufhebung, die in jedem Gedanken mitgedacht werden muss, sondern als leidlich zu nennendes Alibi.
Das nicht zuletzt für die Theoriebildung zentralste Geschehnis unserer Epoche, der faschistische Massenmord, ist bei weitem nicht das einzige, aber wohl das schwerwiegendste, was uns von der Zeit, in der Karl Marx politisch aktiv war und aus der Lukas strategisches Kapital schlagen will, trennt. Möglicherweise zeugt die Entwicklung von Theorie aus Praxisversuchen, die Lukas bei Marx sehen will, von jenem linkshegelianischen Fortschrittsglauben, der sich mit der faschistischen Barbarei blamiert hat – was es heute umso mehr nötig macht, Praxis gründlich zu durchdenken und zu reflektieren, auch weil die materiellen Verhältnisse und ihre ideologischen Reflexionsformen, dem Denken und Handeln der Menschen vorgängig sind. Und auch wenn Lukas selber eingesteht, dass sein Vergleich hinken könnte, wird er sich fragen lassen müssen, in welcher Weise ihm die politischen Verhältnisse von damals und heute, nach der Erkenntnis, dass Fortschritt in dieser Gesellschaft als Fortschritt in der Entmenschlichung zu denken ist, vergleichbar erscheinen. Die Marx’sche Politik wie politische Agitation ist kein in die heutige Zeit zu übertragendes strategisches Schema, sondern, wie Horkheimer das einmal schrieb, „richtiges Bewusstsein in einer bestimmten Phase des Kampfes“. Marx kämpfte in einer Zeit, in der alles noch offen und möglich schien. Doch was vor Auschwitz einmal richtig war, ist es heute nicht mehr, weil in jeder „Revolution“ verdinglichter Bewusstseine die Regression zur Barbarei schlummert. Marx konnte nicht ahnen, dass die Menschen im Stande ihrer Unfreiheit zur Ausrottung schreiten würden, anstatt das Verhältnis abzuwerfen, das sie in Unfreiheit hält. Wie auch. Für die planvolle Vernichtung von Millionen Menschen gab es keine Gründe, die durch die, wie stark auch immer vorausahnende Vernunft eines Marx, hätten erdacht werden können. Marx kämpfte für die Befreiung der Menschheit. Er ahnte nicht, dass die Deutschen jene Idee von Menschheit, von einem Verein freier Menschen, unrettbar beschädigen würden bzw. muss man Marx zugute halten, dass, wenn einer, dann er die Sonderstellung der Deutschen zur Welt schon in ihren Anfängen kritisiert hatte.
Die bürgerliche Gesellschaft nach Auschwitz ist, was ihre Verkehrsform betrifft, im Wesentlichen nicht von der der Marx’schen Analyse zu unterscheiden, wohl aber, was ihre Veränderbarkeit betrifft. Mit Auschwitz und der daraus resultierenden Erkenntnis, dass die moderne Gesellschaft nur durch die Analyse des Antisemitismus zu verstehen ist, ist die stärkste Zäsur benannt, doch auch andere Veränderungen beispielsweise im Charakter von Ideologie oder von der Verhärtung des Bewusstseins ließen sich anführen, um die Analogie zwischen Marx’schem Politikverständnis und heutiger Anforderungen an Praxis zurück zu weisen.
Was also heute ansteht, ist keine Suche nach revolutionärer Praxis, sondern die Verteidigung und Verbesserung der Lebensbedingung von Migranten, sozial Benachteiligten und überhaupt all jenen, die „auffallen ohne Schutz“ (Horkheimer/Adorno). Wenn etwa in Duisburg-Rheinhausen8 oder Berlin-Hellersdorf9 heute Zustände eingetreten sind wie vor den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen 1992, wenn in Arnstadt Soldaten der Bundeswehr in ihrer Freizeit auf das Heim der Asylbewerber losgehen10 oder in der Schweiz an bestimmten Standorten Flüchtende u.a. mit Ausgangssperren drangsaliert werden, dann ist das ein Ausweis gesellschaftlicher Kälte, die anzeigt, was möglich und was praktisch geboten ist. Die Antifa muss, mit anderen Worten, dafür eintreten, dass sich der von Lukas so sicher nicht gedachte Wunsch, dass „sich revolutionärer Wille und der elende Vollzug des Alltagslebens aneinander entzünden“ (Lukas) nicht im Anzünden von Menschen äußert, wenn der revolutionäre Wille beim rechten Mob zum Wille zur Ausrottung degeneriert ist. Antifaschistische Praxis hat aber eben nicht nur die Aufgabe, sich gegen die Angriffe von Nazis und rechtem Wutbürgertum zu stellen, sondern auch, zumindest in der Theorie die Alternative zu bewahren, bis ihr Zeitpunkt gekommen ist.
1 Lirabelle #1, Juni 2013, S. 13-15. Online: http://lirabelle.blogsport.eu/2013/07/03/kategoriale-kurzschluesse/
2 Lirabelle #1, Juni 2013, S. 16-19. Online: http://lirabelle.blogsport.eu/2013/07/04/hals-bein-und-andere-brueche/
3 Lirabelle #1. Juni 2013, S. 20-29. Online: http://lirabelle.blogsport.eu/2013/07/04/probleme-der-a-und-die-geheimnisse-der-schoenen-seele/
4 Broschüre „Stadt der Vielfalt?“, November 2012, S. 36-37. Online: http://agst.afaction.info/index.php?menu=news&aid=539
5 Eva Felidae: Gedanken über das Verhältnis kategorialer Kritik und konkreter Politik. In: Broschüre „Stadt der Vielfalt?“, November 2012, S. 38-39. Online: http://agst.afaction.info/index.php?menu=news&aid=553
6 Der vermeintliche Freund der Empirie, Karl Meyerbeer, bespaßt die Leser stattdessen mit aberwitzigen Behauptungen, wie der, dass sich heute lächerlich mache, wer öffentlich behaupte, „die Bänker und Manager seien das Problem am Kapitalismus“. Vielleicht täte ein Blick in die Empirie dem unkritischen Kritiker Meyerbeer wirklich gut. Die Markierung von vermeintlich Schuldigen gilt nämlich nicht nur, aber vor allem in der politischen Linken, als gern gesehener Ersatz für Gesellschaftstheorie, etwa bei „Occupy“ und anderen Verfallsformen der Antiglobalisierungsbewegung. Dass bürgerliche Ökonomen wie Hans-Werner Sinn solche Personifizierungen zurückweisen, ist kein Argument für die Hegemonialität bzw. in Meyerbeers Diskurs-Jargon: Diskursmächtigkeit dieser Position, sondern dessen vergeblicher Versuch die moralische Integrität seiner Klasse vor der drohenden Lynchjustiz des Mobs zu rehabilitieren.
7 Vgl. dazu den in dieser Ausgabe erschienen Artikel von Simon Rubaschow.
8 http://campuswatchude.wordpress.com/2013/08/18/ubergriffe-und-hetze-gegen-roma-in-rheinhausen-schaut-die-polizei-weg/
9 https://linksunten.indymedia.org/de/node/92919
10 http://agst.afaction.info/index.php?menu=news&aid=590
Verstehen ≠ Überstehen
Simon Rubaschow interveniert in die aktuelle Debatte um das Verhältnis von Theorie und Praxis. Der Autor ist Mitglied im Club Communism.In der letzten Ausgabe der Lirabelle entspannen sich an einer Auseinandersetzung mit zwei Texten1 aus der Broschüre Stadt der Vielfalt? Anfänge einer Diskussion um das berüchtigte Theorie-Praxis-Verhältnis. Eine Position sogenannter „kategorialer Kritik“ wurde als „reine“ und „leere“ Theorie kritisiert, ihr gegenüber steht der Anspruch einer auf die Empirie vermittelten Kritik, die ein „dialektisches Verhältnis von Theorie und Praxis“ herstellt. Was damit gemeint sein kann, versuche ich folgend auszuführen, in der Absicht, mit dieser Konkretisierung des Theorie-Praxis-Verhältnisses zugleich eine Kritik an den drei Artikeln2 der letzten Lirabelle zu leisten.
Kein Happy-End in Sicht
Von der Empirie auszugehen hieße für radikale Theorie, von den Bedingungen radikaler Praxis auszugehen. Das sind zunächst die gesellschaftlichen Reproduktionsbedingungen, denen wir alle unterworfen sind: Wir wollen essen, wohnen, Kleidung tragen, gegebenenfalls Schnaps trinken oder andere schöne Dinge machen – die meisten davon kosten Geld, also müssen wir uns mit dem Amt herumschlagen, arbeiten oder Mutti3 erklären, warum das Taschengeld nicht reicht. Verkürzt gesagt: Kapitalismus. Diese Form der gesellschaftlichen Reproduktion, also das gesellschaftliche Sein, ist es, das unser Bewusstsein prägt. Weil wir uns in ihm als Objekte von sich gegen uns verselbstständigten Verhältnissen erleben, vom Kapital als Arbeitskraft angewendet oder vom Amt als Kostenfaktor verwaltet werden, identifizieren wir uns selbst als definierbare und definierte Objekte und werden als solche identifiziert. Als Student, als Frau etc. Und selbst in der angestammten Sphäre des Subjekts, dem Warentausch, sind wir kaum mehr als prognostizierbare Agent_innen gesellschaftlich produzierter Bedürfnisse. Unsere sogenannte Freizeit ist die Zeit, in der wir uns von der Arbeit erholen und unseren Arbeitskraftspeicher wieder auffüllen; indem wir uns zerstreuen, aber auch, indem wir unseren von der Objektivierung und den Zwängen des Alltags geschundenen Selbstwert daran aufrichten, rebellisch, subversiv und ungezwungen zu leben, um Montag wieder bereit zu stehen, schlicht, weil wir müssen. Der Kapitalismus ist also in sofern total, als das er alle unsere Lebensvollzüge, bis zu unseren Bedürfnissen, Hoffnungen und Ängsten, durchdringt und formt. Dass diese Totalität in sich widersprüchlich ist, ist dabei leicht zu erkennen. In einer Gesellschaft, in der Häuser leer stehen und Menschen zwangsgeräumt werden, in der die Würde des Menschen unantastbar ist und Menschen in Abschiebeknästen sitzen usw. usf., in der wir als Subjekte angesprochen werden und gleichzeitig wie Objekte behandelt, sind die Widersprüche offensichtlich. Sie bedingen aber keine Brüche mit dem Kapitalismus, wie auch Ladendiebstahl oder Hausbesetzungen zwar Rechtsbrüche sind, aber kein Riss im Kapitalismus, sondern zunächst einmal ein – berechtigter – Versuch, im Kapitalismus klar zu kommen. Insofern geschieht alles Tun und Handeln in kapitalistischen Formen und jede Regung, jeder Versuch von Widerstand bleibt immanent im Kapitalismus verhaftet – einfach, weil wir durch den Widerstand gegen konkrete Zwänge nicht gleich aus dem ganzen Mist rauskommen.
Diese Widersprüche verweisen auf eine zweite Bedeutung des Anspruchs, von der Empirie auszugehen. Denn von der Empirie auszugehen heißt derzeit, festzustellen, wie schlecht es um die Bedingungen radikaler Praxis bestellt ist. Der Widerspruch, in dem Menschen im Kapitalismus stehen – Subjekt sein zu sollen, Objekt zu sein – wird von ihnen häufig genug versucht, mittels Rassismus, Sexismus und anderen Abwertungsmustern zu lösen, durch die der eigene Subjektstatus an der Objektivierung anderer erlebt werden kann. Im Nationalismus, Regionalpatriotismus oder die Zugehörigkeit zu kollektivistischen Subkulturen, Fußballfanschaften etc. wird ein Kollektivsubjekt imaginiert, dem gegenüber der Einzelne willig Objekt sein mag. Und der Antisemitismus dient gleichzeitig als Projektionsfläche der verdrängten eigenen Machtphantasien, als Erklärung für das Schlechte in der Welt und lässt die eigene Verstricktheit in den Kapitalismus ebenso wie die durchdringende Bestimmtheit von ihm verleugnen. Diese Widersprüche, zwischen bürgerlichem Gleichheitsversprechen einerseits und den Ungleichheitspostulaten zahlreicher Individuen der bürgerlichen Gesellschaft andererseits, sind grundlegend durch den Kapitalismus bedingt, und gleichzeitig haben diese Widersprüche das Potenzial, tatsächlich einen Bruch im Kapitalismus zu erzeugen. Zweifelsohne aber ist dieser Bruch keiner, der aus emanzipatorischer Perspektive genutzt werden kann. Radikale Praxis, die sich auf diesen Bruch bezieht, kann sich einzig negativ, als Abwehr, auf ihn beziehen. Damit ist sie zunächst Verteidigung der vorhandenen widersprüchlichen Totalität – Kapitalismus und bürgerliche Gesellschaft mit ihrer Spannung zwischen formaler Gleichheit und realer Ungleichheit – gegen die Versuche, selbst die formale Gleichheit der Individuen abzuschaffen.
Emanzipatorische Brüche dagegen sind hier und derzeit nicht in Sicht; wir leben in nichtrevolutionären Zeiten. Mehr noch, die radikale Linke befindet sich in einer Situation theoretischer und organisatorischer Ohnmacht. Es gibt derzeit keine theoretische Perspektive auf die wirkliche Bewegung, die diese, unsere derzeitigen Verhältnisse aufhebt. Was es für diese wirkliche Bewegung bedeutet, dass eine negative Aufhebung des Kapitalismus – Auschwitz – möglich war und ist, ist ebenso wenig durchdacht wie die Veränderungen des Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten, etwa in Hinblick auf die gesellschaftliche Bedürfnisproduktion. Die Niederlagen, die emanzipatorische Kämpfe in den letzten 150 Jahren erlitten haben, sind nicht aufgearbeitet und – abseits der weltgeschichtlichen Ereignisse – vielfach vergessen; das Scheitern und die Vereinnahmung ihrer scheinbaren Siege ist ebenso wenig verstanden. Wie die Arbeiter_innen zu Dialektiker_innen werden sollen, niemand weiß es. Und die organisatorischen Bedingungen, diese Fragen zu beantworten oder auch nur zu stellen, sind allenfalls rudimentär vorhanden. Jede Theorie, die von der Empirie ausgeht, muss es im Angesicht dieser Ohnmacht tun, und jede Praxis muss darauf zielen, diese Ohnmacht zu überwinden, ohne sie zu verleugnen.
Vom Elend ist auszugehen
Diese Ohnmacht ist den drei Texten, von denen ich hier ausgehe, durchaus bekannt. Ihre große Sorge besteht darin, dass die Theorie diese Ohnmacht nicht angreifbar macht, sondern verlängert. Dazu bestimmen sie Bedingungen für gute Theorie, sie soll „zumindest einen Bezug auf eine bessere, radikalere Praxis“ und den „Ansatz für Destabilisierung“ geben, den die Praxis nutzen kann, „auch wenn man sich dafür die Hände schmutzig machen muss.“ Was sie nicht tun soll, ist „vom Leuchtturm der reinen Kritik aus über die schlechte Welt orakeln“, die Realität nicht „mit der Tünche der theoretischen Totalität“ überfärben, keine „abgrenzende Polemik“ sein, sondern von „Praxisversuchen“ ausgehen und deren „Impulse selbst aufgreifen“. Kurz: Theorie soll also der Praxis zuarbeiten, das Kampffeld bestimmen, die Schwächen des Gegners sichtbar machen und die Waffen auswählen. Theorie, derart bestimmt, soll vor allem Strategie sein.
Ein solches Verständnis von Theorie hat ein doppeltes Problem: Zum einen, aber das ist das kleinere Problem, ist das geforderte „dialektische Verhältnis“ hier nicht mehr vorhanden. Nicht Dialektik, sondern Unterordnung und Ableitung bestimmen die Theorie von der Praxis aus. Entscheidender ist jedoch, dass ein solches Theorie-Praxis-Verhältnis selbst nicht von der Empirie (den gesellschaftlichen Verhältnissen) ausgeht, indem sie die Einsicht in die Ohnmacht der radikalen Linken von vornherein verweigert. Das Postulat, die Widersprüche zu suchen und sofort als (progressive) Brüche zu identifizieren, aber die Totalität des Kapitalverhältnisses absichtlich zu ignorieren, verhindert jenen Abstand, in dem allein eine Perspektive auf die Aufhebung der Verhältnisse zu gewinnen wäre.
Dieses Problem wird in einer Theorie, die sich gleichsam organisch an die Praxis anschmiegt, unsichtbar gemacht; dieses Problem ist es auch, dass in dem scheinbaren Auseinanderfallen von Theorie und Praxis etwa bei den AGST (und damit der AAI, die im Fokus der Kritik der drei Texte der letzten Lirabelle stand) sichtbar wird. Die scheinbar „seltsame Diskrepanz zwischen ihrer Praxis einerseits und ihren Texten und Redebeiträgen andererseits“ liegt meines Erachtens darin begründet, dass sie darum wissen, dass ihre Praxis derzeit nicht revolutionär sein kann, und daher auch nicht versuchen, revolutionäre Praxis zu machen. Der Ort, an dem ihre Perspektive auf die wirkliche Bewegung überwintert, ist folgerichtig ihre Theorie. Das derart Praxis letztlich eine Verteidigung des Schlechten (der bloß formalen Gleichheit aller im bürgerlichen Staat) gegen das Schlechtere (organisierte Nationalsozialist_innen und den ganz normalen deutschen Mob) wird und die Theorie abstrakt, ergibt sich aus der Situation von Kommunist_innen im Thüringer Wald. Was sie vom bloßen Reformismus scheidet, ist ihr Benennen der Produktion dieses Schlechteren durch das Schlechte, die bürgerliche Gesellschaft. Ihre Praxis ist damit die eines sich bewussten Sisyphos und die tendenzielle Abstraktheit ihrer Theorie ist Ausdruck ihrer konkreten Situation – während sich Praxis, die sich revolutionär gibt, ohne es sein zu können, in blinder Abstraktheit verliert.
Die Theorie muss konkret werden: Widerspruch
Da Sie, werte Leser_innen, es bis hier durchgehalten haben, komme ich nun endlich zu meinem Versuch der Antwort auf die Frage: Theorie und Praxis, dialektisch vermittelt, was soll das denn heißen?
Theorie muss, wie schon erwähnt, von der Empirie ausgehen. Diese Empirie, das sind zum einen die Verhältnisse, die als widersprüchliche Totalität existieren, d.h. als umfassende, alles durchdringende, sich durch Widersprüche hindurch reproduzierende. Zum anderen ist die Empirie, von der auszugehen ist – die Ohnmacht der radikalen Linken – eine theoretische wie organisatorische Ohnmacht. Diese Empirie ist es, die zu überwinden ist, sie ist das Negative, dessen Positives die wirkliche Bewegung wäre. Dementsprechend kann Theorie sich nicht anders auf diese Empirie beziehen als negativ: Theorie kann nur als Kritik progressiv sein.
Diese Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Praxis als negativ und kritisch bedeutet auch, dass Theorie der Praxis nicht einfach unterzuordnen ist, sie nicht einfach von der Praxis in Dienst genommen und inhaltlich oder formal bestimmt sein kann. Dialektisch vermittelt heißt eben auch vermittelt, nicht unmittelbar. Der Abstand zwischen Theorie und Praxis ist notwendig, weil die Praxis in nichtrevolutionären Zeiten notwendig eine Praxis ist, die sich innerhalb des Kapitalismus und seinen Widersprüchen bewegt. Diese Praxis ist dennoch gerechtfertigt, weil sie die Bedingungen des konkreten Lebens verbessert. Theorie jedoch, die sich an diese notwendig reformistische Praxis anschmiegt, wird (ob sie will oder nicht) zum rechtfertigenden Nachvollzug der bestehenden Verhältnisse. Der Widerspruch zwischen Theorie und Praxis ist also nötig, solange die Verhältnisse widersprüchlich sind, damit Theorie überhaupt radikal sein kann. Nur als Kritik des Bestehenden, das auch die eigene Praxis umfasst, kann sie überdauern. Dass diese Kritik dabei allzu leicht abstrakt und allgemein wird, ist ein Problem, vor dem sie ebenso steht wie die Praxis, die sich in ritualisierten Formen und Phrasen ausdrückt, weil sie eben derzeit Teil des herrschenden Spektakels ist und einzelne seiner immanenten Widersprüche ausdrückt und prozessiert.
Der Anspruch auf Aufklärung, der von den drei Texten als realitätsfern kritisiert wurde, ist damit in der Tat hilflos. Er ist aber auch nicht hilfloser als jene Praxis der radikalen Linken, die ebenso wenig in der Lage ist, alle diese Verhältnisse umzustoßen, aber diese Ohnmacht verleugnet und darob abstrakt wird. Im Gegenteil: Darin, dass jene Aufklärung und der erhoffte „Bruch im Selbstverhältnis“ nur „die notwendige“ – also nicht hinreichende – „Voraussetzung“ dafür ist, die Verhältnisse zu erkennen, und die AAI gleichzeitig darum weiß, dass damit der „Gewalt der gesellschaftlichen Verhältnisse [] nicht beizukommen“ ist, findet eine Ohnmacht ihren Ausdruck, die anzuerkennen Bedingung für ihre Aufhebung ist. Ohne diese Aufklärung bleibt die Praxis notwendig blind und damit gefangen in der Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie ist dann nur möglich als Reformismus oder als Kampf um die Macht (ob nun leninistisch oder gramscianisch), anstatt als Abschaffung alles Kämpfens um Macht.
1 Zur Notwendigkeit kategorialer Gesellschaftskritik. Redebeitrag der Antifa Arnstadt-Ilmenau bei der ‚Frust’-Demo am 13.10.2012 in Erfurt und Gedanken über das Verhältnis kategorialer Kritik und konkreter Politik. Auswertungspapier zur ‚Frust’-Demo am 13.10.2012 in Erfurt von Eva Felidae.
2 Karl Meyerbeer: Kategoriale Kurzschlüsse, Peter Gispert: Hals-, Bein- und andere Brüche und Lukas: Probleme der Praxis und die Geheimnisse der schönen Seele.
3 bzw. dem (sozialen) Elter, dass dafür zuständig ist.
Ordnungsruf aus dem Altersheim
Ox Y. Moron weist Peter Gisperts Versuch, die Theorie im wattierten Verkehr abzuschaffen, zurück.In der vergangenen ersten Ausgabe dieser Zeitschrift gab sich Peter Gispert als einer von drei Desperados die Ehre, gegen zwei Texte bzw. die Ansätze von Eva Felidae und der Antifa Arnstadt-Ilmenau zum Verhältnis von Theorie und Praxis zu opponieren. Kurz gesagt, argumentierten Felidae und die Antifa Arnstadt-Ilmenau für eine theoretisch reflektierte Praxis, die in einer total vergesellschafteten Gesellschaft den Verblendungszusammenhang, der sich vor die wirklichen Verhältnisse geschoben hat, durch kategoriale Kritik durchdringt, um diese Gesellschaft zunächst überhaupt als im Wesen veränderbar begreifbar zu machen. Wer etwas abschaffen, aufheben oder verändern will, tut nämlich gut daran, zunächst zu verstehen, womit er es zu tun hat. Angesichts verhärteter und unbewusster Verhältnisse genügt dafür nicht die gut gemeinte Information, sondern es bedarf der die unbewussten Vergesellschaftungsformen durchdringenden Reflexion, es bedarf der Brüche im gesellschaftlich-hergestellten Selbstverhältnis der Einzelnen, der Einsicht, dass die Gewalt, die von den Verhältnissen ausgeht, eine gesellschaftlich-notwendige Gewalt ist.
Gispert versperrt sich dieser Einsicht, weil er meint, sie ohnehin schon zu kennen. Und so legt er los, indem er Fetzen aus dem Marx’schen Werk so zusammen dichtet, dass seine zum Teil unbegründeten bis widersprüchlichen Behauptungen Sinn ergeben. Ziel dieser Flickendecke aus Marx-Zitaten ist die Suggestion, bei Marx finde sich ein Primat der Praxis, das er aus der Theorie ableite. Auf den Gedanken, dass das aus der Marx’schen Theorie destillierte Verhältnis zur „einreißenden Praxis“ nach der Praxis der Nationalsozialisten, die nicht nur Millionen Menschen in den Tod, sondern auch die Idee der Menschheit1 einrissen, ein anderes sein müsste, kommt Gispert nicht. Vorwärts immer, rückwärts nimmer – das, war für die Herrschenden im DDR-Staatskapitalismus noch Ideologie zur Anstiftung der Massen, für den Bewegungslinken Gispert ist es der Glaube an die Allmacht der Rationalität2, der so zeitlos zur Ideologie des Kapitalismus gehört, wie er angesichts der Geschichte sich als geschichtslos blamiert hat. Nach Auschwitz möchte der Bewegungslinke Gispert am liebsten bei Marx’ elfter Feuerbachthese weitermachen, wonach es, nach der Interpretation der Welt, darauf ankomme, diese endlich zu verändern. So sieht das also aus, wenn Linke einen Schlussstrich unter die Geschichte ziehen und es spricht Bände über das Verhältnis dieser Linken zum Nationalsozialismus, über den etwa von Moishe Postone schon in den 80er und 90er Jahren kritisierten Wunsch dieser Linken nach Normalisierung.3
Glaubensfragen
Anstoß seiner Kritik ist zunächst ein Gedanke aus dem Text von Eva Felidae, die die kollektive Erkenntnis – und damit meint Felidae nicht weniger als die Aufklärung jedes Einzelnen über die sich hinter den Rücken der Menschen verselbständigten Formen der Vergesellschaftung – zur Voraussetzung von aufhebender Praxis erklärt. Die Frage nach dem „Was tun?“ wird obsolet in dem Sinne, dass die Gesellschaft, die das in ihr schlummernde Unwesen erkannt hat, von jener Erkenntnis selbst zur Praxis getrieben wird, dass sie emphatisch gesprochen zur Wahrheit über ihren eigenen Begriff schreitet, aufhebt, was Quelle endlosen Leidens ist. Nun kann man der Genossin sicher vorwerfen, dass dieses Verständnis von Praxis etwas einfach gedacht ist, dass auch nach der kollektiven Erkenntnis des gesellschaftlichen Unwesens die Organisation einer nichtkapitalistischen Gesellschaft zu regeln ist, dass die Genossin – aus gutem Grund – also die Frage der aufhebenden Praxis zunächst umgeht; ihr vorzurechnen, sie mache aus Praxis ein bloßes Gedankending, ist falsch. Eva Felidae beschreibt die Erkenntnis des Unwesens als die notwendige, nicht aber als hinreichende, Bedingung seiner Aufhebung. Insofern steht sie vor der Ohnmacht, die Frage nach der aufhebenden Praxis – die Frage nach richtiger Praxis4 ist beantwortet: Aufklärung über unverstandene Verhältnisse – nicht beantworten zu können, weil sie über die Hindernisse, die solch revolutionärer Praxis im Weg stehen, weiß.
Dass Peter Gispert den Widerspruch bzw. die Situation der Ohnmacht, die Eva Felidae zu Papier bringt, nicht verstanden hat, wird deutlich, wenn er schreibt: „Um Kapitalismus abzuschaffen genügt es nicht, wenn wir alle ganz fest daran glauben, dass wir uns selbst nur Gewalt antun.“ Der Glaube – und offensichtlich meint Gispert, es ginge in (anti-)politischen Auseinandersetzungen um Glaubensfragen – Felidae wie der Antifa Arnstadt-Ilmenau ginge es darum, Menschen von der Wahrscheinlichkeit zu überzeugen, dass ihre Position die richtige ist, blamiert Gisperts Ansatz und macht die Auseinandersetzung schwer. Wenn wir nämlich nur noch über Meinungen und Glauben reden und jeder sich notfalls auf seine unumstößlich-persönliche herauszureden meint, können wir die Sache lassen. Weder Eva Felidae noch der Antifa Arnstadt-Ilmenau geht es darum, die Menschen etwas glauben zu machen, ihnen die Wahrheit anzupreisen oder aufzuschwatzen, denn: „Durch den Umstand, daß die Menschen sich zur Einsicht erst überreden lassen mußten, wäre die Wahrheit für immer vergiftet.“ (Pohrt) Es geht vielmehr darum, Aufklärung im besten Sinne zu betreiben, den Menschen die Wahrheit über die Gesellschaft und ihre Gewalt mit Evidenz begreifbar zu machen. Solche Aufklärung ist keine von den Aufklärern ans Volk verordnete, keine Belehrung über dies und das, keine Agitation und Propaganda, sondern solche Aufklärung ist gedacht als Erkenntnis der Gesellschaft, der man selbst angehört und schon deshalb zuerst als Selbsterkenntnis. Im aufklärerischen Prozess soll das Individuum sich selbst, seiner Präformierung durch die objektiven Verhältnisse, bewusst werden. Dieser Bewusstwerdung geht ein Bruch im Selbstverhältnis der Einzelnen voran, der den Kitt von Ideologie, der zwischen den Subjekten und ihrer Selbsterkenntnis steht, lockert und zu dem die Antifa Arnstadt-Ilmenau und Eva Felidae beitragen wollen. Und: Solche Aufklärung bringt das Bedürfnis nach der Veränderung des Selbst und der Gesellschaft mit sich und widerlegt die unwahre Behauptung Gisperts, wonach Theorie bzw. theoretische Erkenntnis „niemals [Praxis] sein kann.“
Dass Gispert aber lieber glauben als begreifen will, wird auch am Fortgang der Argumentation sichtbar. Die Brüche im Selbstverhältnis, zu denen radikale Aufklärung, wie sie die inkriminierten Texte einfordern, beitragen will, missversteht Gispert als Ärger der Leute beim Arbeitsamt. Er setzt die Unzufriedenheit der Einzelnen mit bestimmten Dingen mit der fundamentalen Erkenntnis von gesellschaftlich-notwendigen Selbstwidersprüchen in eins. Sicher kann erstere zu letzterer werden, sie ist es aber nicht a priori. Dass Menschen beim Arbeitsamt und anderswo schikaniert werden, führt noch lange nicht dazu, dass sie dafür die objektiven Verhältnisse und ihre Verstrickung darin verantwortlich machen, dass sie den menschenfeindlichen Charakter der Ordnung erkennen, ihr Unwesen begreifen. Viel näher liegt dem Einzelnen, die Schuld beim Ausländer oder bei der falschen Politik zu suchen. Die Lösung – und die Praxis im Sinne von Gispert – ist dann im besten Fall, dass die Betroffenen beim nächsten mal (wieder) die Linkspartei wählen und/oder mehr Stütze fordern. Eva Felidae und der Antifa Arnstadt-Ilmenau geht es dann nicht darum, die Forderung nach mehr Stütze abzubügeln, sondern sie als das einzuordnen, was sie ist, eine immanente Anforderung an den Moloch, der für Ausbeutung, Entfremdung, Verdinglichung, usw. verantwortlich ist. Bei solch naheliegenden und vielleicht deswegen reformistischen Forderungen schon von einem Bruch im Selbstverhältnis zu sprechen, wie ihn etwa die Antifa Arnstadt-Ilmenau beschreibt und wie Eva Felidae ihn impliziert, ist absurd. Weil hierüber krasses Unverständnis bei Gispert herrscht, kann er die Position von Eva Felidae und der Antifa Arnstadt-Ilmenau nur als böses, abgrenzendes Verhalten von jenen verstehen, die sich doch für ein besseres Leben einsetzen. Eben weil Gispert nicht versteht, dass die Form der Vergesellschaftung über die Kämpfenden hinweggeht, sich reproduziert, wenn sie unverstanden bleibt, muss er seinen Diskussionspartnern Distinktion und eine „Strategie der Ohnmacht“ vorwerfen, muss er denen, die auf sie reflektieren, vorwerfen, sie würden die Ohnmacht propagieren. Und weil diese Abwehr in putativer Weise geschieht, garniert er sie mit einem Ordnungsruf gegen die polemisch auftretende Theorie. Polemik begreift Gispert nur als Mittel der Abgrenzung, die Identität und Sicherheit gewährleisten soll, aber das Gegenüber nicht mehr erreicht – statt zu begreifen, dass nur in der Zuspitzung die Wahrheit über den Gegenstand vor Meinungsbildung und Glaubensfragen zu retten ist.
Umgangsformen
Dabei kann man am heutigen Zustand der Linken ablesen, wohin einen die Nettigkeiten gebracht haben. Diese Linke befindet sich nämlich in einem erbärmlichen Zustand, was ihr theoretisches Niveau angeht. Die größten Teile dieser Linken sind Reformisten, also Kapitalismusverbesserer – ob sie nun darum wissen (SPD) oder nicht (Jusos, Linkspartei und Anhang) – und die Splittergruppen, die nach wie vor an seiner Abschaffung festhalten wollen, gleichen einem Sektenwesen, bei dem Theoriebildung durch Glaubensbekenntnisse ersetzt worden ist. Dazu kommt eine akademisierte Linke, die durch postmodernes Diskursgesülze regelrecht verblödet ist. Was in dieser Linken eine Randerscheinung ist, sind Gruppen und Personen, die klare, theoretisch begründete Positionen offensiv vertreten und sich nicht in jeder ihrer Äußerungen für die Relativität ihres Denkens entschuldigen müssen, weil sie den Anspruch auf Wahrheit, wie die Postmodernen, für ein ideologisches Relikt oder postmodern formuliert: Konstrukt des Sowjetmarxismus halten.
Die „wattierten“ Umgangsformen in dieser Linken – das hat Wolfgang Pohrt einmal beschrieben – lassen auf linken Gruppen- und Bündnistreffen eine Atmosphäre wie im Altersheim entstehen. Im wattierten Verkehr soll jeder seine Meinung, seinen Glauben, seinen Wahn äußern dürfen, ohne dafür kritisiert zu werden und – das ist die Kehrseite – ohne dafür ernst genommen zu werden: „Wer Unsinn redet, erfährt nicht durch Kritik, daß er auch anders könnte und sich gefälligst anzustrengen hat. Statt dessen gibt ihm die herzlose Toleranz der Genossen zu verstehen, daß er sich als Sozialfall zu betrachten hat, von dem man gar nichts anderes erwartet.“ Etwas nicht zu wissen oder nicht zu verstehen, ist keine Schande, schändlich ist sich dieses Defizit zum Wesensmerkmal des Einzelnen zu rechtfertigen und so zu tun, als ob Leute, die dumme Sachen sagen und tun, dafür schon ihre subjektiven Gründe haben und dafür nicht kritisiert gehören.
Die Polemik ist ein Mittel, das solchen Umgangsformen ein Ende macht und zum Streit fordert. Sie zielt nicht auf das streitende Subjekt und ist deswegen kein „Runtermachen“, sondern sie zielt auf den streitbaren Gegenstand. Insofern ist Polemik abzugrenzen etwa von Formen der ordinären Publikumsbeschimpfung, wie sie etwa die Antifa Task Force Jena – und wie ich das sehe, an dieser Stelle völlig richtig – bei einem Bratwurstfest gegen Rechts in Kahla betrieben hat5. Polemik hat ihre Stärke darin, dass sie dem Meinungsrodeo der pseudopluralistischen deutschen Öffentlichkeit eine Absage erteilt und darin, dass sie Verhärtungen der gesellschaftlichen Verblendung aufbricht. Dass sie dabei hin und wieder „unredlich“ vorgeht, wie linke Spießer unken, weil sie nicht überall das Für und Wider abwägt, sondern Streit provoziert in dem Wissen, dass sich gerade darin nachhaltiger Erkenntnisse gewinnen lassen, als im lauen Werben um Zustimmung – geschenkt.
Der Ordnungsruf von Peter Gispert ist also sowohl in methodischer wie in inhaltlicher Hinsicht – sofern man das trennen mag – zurückzuweisen. Die sich der eigenen Ohnmacht bewusst machende, polemisch zuspitzende Kritik und damit Praxis gegen unbewusste und verhärtete Vergesellschaftungsformen mag den durchschlagenden Erfolg vermissen lassen. Sie ist gegen jeden Angriff, sie gegen pragmatisches Mitmachen einzutauschen, zu verteidigen.
1 Das meint die Idee eines solidarischen Miteinanders einer die Differenzierung nach Hautfarben, sexuellen Vorlieben, etc. zurückweisenden Menschheit, den über den Globus sich erstreckenden Verein freier Menschen, der die Verhältnisse von Staat und Kapital mit diesen ebenso wie ihre ideologischen Reflexionsformen aufgehoben hat.
2 Bezeichnend für solchen geschichtslosen Fortschrittsglauben ist, dass Leute wie Gispert überall „Radikalisierungsprozesse“ sehen, fördern und sich durch „kleine Schritte“ dem Ziel nähern wollen. Warum die „Radikalisierer“ seit Jahrzehnten bestenfalls auf der Stelle treten bzw. jeden gesellschaftlichen Fortschritt, den das Kapitalverhältnis mit sich bringt (z.B. die Eingliederung der Frauen in den Arbeitsprozess und die damit einhergehende rechtliche Gleichstellung) als Sieg der „Bewegung“ feiern, hinterfragen die wenigsten.
3 Für die begründete Zurückweisung dieses Bedürfnisses der deutschen Linken, eine normale Opposition in einem normalen Land zu sein, die nicht nur Peter Gispert durchblicken lässt, wäre eine gesonderte Auseinandersetzung nötig.
4 Das schließt das Eintreten für die Verbesserung der Lebens- und „Kampfbedingungen“, also eine reformistische Praxis, die aber auf ihre eigene Verflochtenheit reflektiert und deswegen über sich hinaustreibt, mit ein. Die Vorstellung von Aufklärung als Schmökerstunde mit Marx und Adorno greift zu kurz. Sie ist auch als Reflexion auf die Beschränktheit oder Vergeblichkeit realer Kämpfe, sie ist Kritik im Handgemenge. Die Praxis der Antifa Arnstadt-Ilmenau könnte einige Beispiele liefern.
5 http://atfjena.blogsport.eu/2013/06/15/redebeitrag-aus-kahla/