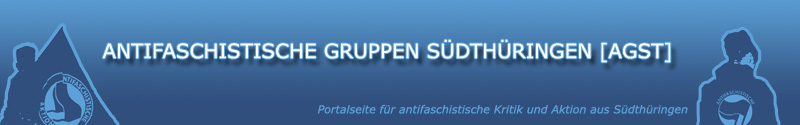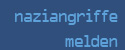



Für aktuelle News checkt bitte unseren neuen Blog!
Erfurt: Redebeiträge zur Kritik der bürgerlichen Anti-Nazi-Proteste und zum Abfeiern des 1. Mai durch die Sozialdemokratie
Zur sozialrevolutionären Nachttanzdemo am Vorabend des 1. Mai in Erfurt gab es einiges auf die Ohren. Besonders aufgestoßen ist vielen Teilnehmer_innen ein Redebeitrag der Antifa Arnstadt-Ilmenau, der die bürgerlichen Anti-Nazi-Proteste des „Keinen Meter“-Bündnisses als konformistische Veranstaltung bloßstellte. Weiterhin gab es einen hören- und lesenswerten Beitrag des Club Communism, der den geschichtsvergessenen Umgang der sozialdemokratischen Linken mit dem 1. Mai kritisierte. Wir dokumentieren beide Texte.
Redebeitrag der Antifa Arnstadt-Ilmenau
Redebeitrag der Antifa Arnstadt-Ilmenau zur Kritik der bürgerlichen Mobilisierung gegen den Naziaufmarsch
Morgen wollen in Erfurt der Nazi Michel Fischer und seine Mischung aus Karnevalsverein und verspäteter SA aufmarschieren. Dagegen mobilisiert ein bürgerliches Bündnis, das sich darum bemüht hat, sich einen gesellschaftskritischen Anstrich zu verpassen. Um es vorwegzunehmen: Wir halten die Mobilisierung dieses Bündnisses für eine durch und durch konformistische Veranstaltung und raten von einer Teilnahme an den Aktionen dringend ab; nicht weil wir möchten, dass die Nazis laufen können, sondern weil wir uns mit der Teilnahme an einer solchen Aktion in ein Spektakel einfügen, das nichts anderem dient als der Profilierung dieser Stadt und dieses Landes als weltoffen und tolerant. Wie solche Blockaden in der Vergangenheit abliefen, ist bekannt. Einige hundert Menschen blockierten die Straßen, unter ihnen großteils Antifas, Punks, radikale Linke. Im Nachhinein durfte man lesen, hören und sehen: „Stadt XY wehrt sich gegen Naziaufmarsch“. Wir wollen diese Stadt, dieses Land nicht vor den Nazis verteidigen, wir wollen kein Teil einer Aktion werden, die dahingehend ausgelegt wird. Uns geht es nicht nur um die Nazis und ihre Aufmärsche. Wir betrachten die Naziideologie als notwendigen Teil dieser Gesellschaft. Die Ideologie der Nazis repräsentiert eine radikalisierte Form der bürgerlichen Ideologie, ihre Krisenform. Uns geht es darum die Ambitionen der Nazis als der Gesellschaft innewohnende Tendenz ihrer falschen Aufhebung begreifbar zu machen und damit die Gesellschaft als menschenverachtende bloßzustellen.
Der Aufruf des „Keinen Meter“-Bündnisses genügt diesem Anspruch nicht im Mindesten. Er ist vielmehr Ausdruck geschichtslosen Bewusstseins, eines Denkens, das sich frisch-fröhlich ans Werk macht, und allen historisch-gesellschaftlichen Entwicklungen gegenüber blind ist; ein Denken, das mit der Herrschaft gemeinsame Sache macht, weil es zum Vergessen anleitet. - Wir haben die Geschichte dieses Landes nicht vergessen, wir haben die niedergeschlagenen Kämpfe um eine andere Gesellschaft nicht vergessen, wir haben die Niederlagen, die mit dem 1. Mai verbunden sind nicht vergessen, wir haben die Räumung des Besetzen Hauses nicht vergessen, wir haben die unzähligen Übergriffe durch den Staat und seine Hüter nicht vergessen. Jeder Kampf kann nur mit dem Bewusstsein dieser Vergangenheit geführt werden, er muss in dem Bewusstsein geführt werden, dass die Bedingungen der faschistischen Barbarei in der kapitalistischen fortdauern. Ohne das Bewusstsein um die Menschenfeindlichkeit dieser Gesellschaft, die ihre Grundlage in den Formbestimmungen der Warenproduktion hat, ist jeder Kampf zur Affirmation der bestehenden Verhältnisse verdammt, er endet im Räderwerk einer Ordnung, die sich alles einverleibt, was nicht ihre Aufhebung bedeutet. In solchem Bewusstsein sind die Kämpfe gegen Naziaufmärsche zu führen. Wo sie nicht übergehen in eine kategoriale Kritik der bestehenden Gesellschaft, wo sie nicht die Aufhebung der Naziideologie mit der sie bedingenden Gesellschaftsordnung implizieren, verfallen sie der Affirmation.
Die Politstrategen des Bündnisses mögen die Absicht leugnen, Imagepflege oder Affirmation der bestehenden Verhältnisse zu betreiben. Ihnen geht es tatsächlich nicht primär um die Reinhaltung des Stadtimages, sondern ihnen geht es um Deutungsmacht. Sie wollen mitmischen im Politikbetrieb. Dem liegt ein falsches Verständnis von Gesellschaft zugrunde. Diese Leute wollen Gesellschaft als eine Arena begreifen, in der um politische Einflüsse und Entscheidungen gerungen wird, in der sich Machtblöcke bilden und bewusst gesellschaftliche Veränderungen durch politische Entscheidungen bewirken können. Diese Spielart der Sozialdemokratie, so radikal sie sich geben mag, verendet immer dort, wo die Form jener kapitalen Vergesellschaftung unverstanden bleibt und ihre Logik daher über die linken Politstrategen hinweggeht, wo Wert- und Warenform kryptische Mysterien bleiben, über die man bei Marx lieber hinwegliest. Überhaupt gilt: Wer mitspielen will, muss die Regeln des Spiels akzeptieren und im Kapitalismus geht es bekanntlich nicht um die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern die rastlose Vermehrung von Tauschwerten. Politik bedeutet dann, die unverstandenen und aus dieser Position unhintergehbaren Sachzwänge dieser Ordnung zu verwalten und zu organisieren. Ist dann beispielsweise kein Geld für die Integration von Flüchtlingen da, werden Abschiebungen gerechtfertigt mit eben solchen Sachzwängen. Gut sichtbar überall dort, wo Linke inzwischen mitregieren und abschieben. Eine solche affirmative Linke, die den Kommunismus höchstens als utopisches Ziel in weiter Ferne begreift, dem man sich mit kleinen Schritten nähern will und nicht als aufhebende Bewegung, die dem Elend nachdrücklich ein Ende macht, weil sie bei den gesellschaftlichen Formbestimmungen ansetzt, ist verzichtbar.
Eine Analyse der Entstehungsbedingungen von Naziideologie, ihr Zusammenhang mit der bestehenden mörderischen gesellschaftlichen Praxis, fehlt dem Aufruf des „Keinen Meter“-Bündnisses ohnehin. Die Anschlussfähigkeit des Aufrufes besteht wohl eher darin, dass hier mit der eigenen Borniertheit kokettiert wird. Die Beschränktheit des Denkens verbindet noch jene, die sich real jedes Butterbrot neiden. Den Nazis vorzuwerfen, sie wollen emanzipatorischen Bewegungen ihrer Traditionen berauben, ist so beschränkt wie vielsagend über den Zustand einer Linken, die sich noch in positiver Weise auf eine Arbeiterklasse in Deutschland bezieht und sich nicht die Frage stellt, wie Dinge, die sich Nazis zu eigen machen, als emanzipatorisch gelten können. Überhaupt verbleibt der Aufruf des „Keinen Meter“-Bündnisses, da wo es nicht um eine Chronologie rechter Aufmärsche in Erfurt geht bei pseudoradikalem Floskeltum oder Analysen auf dem Niveau wie der, dass im Kapitalismus Konkurrenzdenken verbreitet ist; eine Aussage mit dem Erkenntnisgewinn, wie dem, dass Wasser nass ist.
Das reaktionäre Potential der Mobilisierung wird vor allem an den Nebengeräuschen deutlich. Überhaupt waren die Politstrategen von „Keinen Meter“, aller berufsbedingten Borniertheit zum Trotz, zu clever oder vielleicht auch einfach nur zu gehemmt, um geradeaus auszuposaunen, worum es wirklich geht. So waren es vor allem die Kommentatoren des Aufrufes, die offen zum Heimatschutz aufriefen, weil es gelte, 'unser schönes Erfurt' vor den Nazis zu verteidigen und weil immer noch der Mob bestimmt, was diese Demokratie toleriert und was nicht. Die organisierten Nazis sind es aktuell grad nicht. Ein weiteres Beispiel für die Blüten, die die Mobilisierung trägt, findet sich in einem der drei Mobilisierungsclips der Filmpiraten. Darin ketten sich vier Menschen unter dem Leitsatz „Mehr riskieren“ mit Fahrradschlössern am Hals aneinander fest, um als menschliche Blockade den Zweck der Verhinderung des Naziaufmarsches der eigenen Gesundheit überzuordnen. Menschen, die so vorgehen, überlassen sich der Willkür derer, auf die sie stoßen werden und das sind morgen entweder die Bullen oder die Nazis. Sich darauf zu verlassen, dass diese oder jene verantwortungsvoll mit einer solchen Situation umgehen, bedeutet nichts anderes als virtuell schon die eigene Gesundheit, vielleicht das eigene Leben für ein vermeintlich höheres Ziel durchzustreichen. Hier wird der vermeintliche Protest gegen einen Naziaufmarsch selber menschenverachtend, totalitär.
Wer also am 1. Mai mit dem „Keinen Meter“-Bündnis auf die Straße geht und sich einbildet, damit etwas anderes zu bezwecken, als die Reproduktion einer Ordnung, die die Nazis so zuverlässig hervorbringt, der irrt. Was hier die Gestalt des Widerstands gegen einen Naziaufmarsch annimmt, ist nichts anderes als ein nur schäbig getarntes Projekt eines alternativen Verfassungsschutzes. Hier hat die radikale Linke, die den Nazis mit der sie hervorbringenden Gesellschaftsordnung ein Ende machen will, nichts verloren. In einer solchen Gesellschaftsordnung sind Rassismus und Antisemitismus keine Marotten des Benehmens oder menschliche Verirrungen, die man den Leuten wie schlechte Manieren durch Sozialarbeit, Menschenrechte oder gutes Zureden abgewöhnen kann, sondern gesellschaftlich-bedingtes, falsches Bewusstsein, das seinen Ursprung in der Bestimmtheit dieser Gesellschaftsordnung hat und nur mit ihr abzuschaffen ist. Rassismus wie Antisemitismus sind Ideologien, die ihre Träger vor der Einsicht in die eigene, gesellschaftlich-produzierte Überflüssigkeit schützen, zu der sie unterm Kapitalverhältnis verdammt sind. Wer rassistische und antisemitische Gewalt nachhaltig bekämpfen will, muss für die Abschaffung dieser Gesellschaftsordnung eintreten, anstatt sie ohne Not vor den Nazis verteidigen zu wollen.
Anstatt also den Nazis hinterherzuhetzen und sich dort niederzulassen, wo die Politstrategen des „Keinen Meter“-Bündnisses das anweisen, ginge es vorrangig erstmal darum zu verstehen, was den Protest gegen Nazis zu einer konformistischen Veranstaltung gemacht hat; warum die Nazis und ihre bürgerlichen Kritiker immerhin ihr gewolltes oder unbewusstes Engagement für den Standort bzw. die Aufrechterhaltung der herrschenden Ordnung verbindet; warum eine Gesellschaft, in der gemordet und ausgebeutet wird, nicht ihrer Abschaffung entgegengeht, sondern ihrer permanenten Reproduktion. Dafür bedarf es unversöhnlicher Kritik und keines pragmatischen Aktionismus, der sich mitschuldig macht. Hinter solcher Kritik steht der Wunsch oder vielmehr die verzweifelte Hoffnung auf etwas ganz anderes. Uns geht es um den Bruch mit dem Immergleichen, um den Sprung ins Offene, der sich seiner historischen und gesellschaftlichen Bedingtheit bewusst ist und gerade deswegen mit ihr brechen will. Nur in solcher unversöhnlicher Kritik scheint derzeit noch negativ das heute verstellte Morgen einer solidarischen und vernünftigen, also kommunistischen Gesellschaft auf. Dafür kämpfen wir.
Redebeitrag des Club Communism
The Weather’s Fine. Die Geschichte des 1. Mai als Geschichte der Niederlagen
Die Zweite Internationale erklärte vor 124 Jahren den 1. Mai zum Tag der Arbeiter_innenbewegung, genauer: zum „Protest- und Gedenktag“. Anders als Gewerkschaften und die linksradikale Szene heute, die meist euphorisch von einem „Feier“- bzw. „Kampftag“ sprechen und damit den eigenen Sieg unhinterfragt mitunterstellen, wussten ihre Aktivist_innen um die schmerzhaften Verluste, die mit diesem Tag verbunden waren.
1886, Chicago
Die Geschichte des 1. Mai begann 1886 mit einem US-weiten Generalstreik zur Erkämpfung des Achtstundentages, bei dem je nach Quelle 300.000 bis 500.000 Arbeiter_innen auf der Straße waren. In Chicago, einer Hochburg der Arbeiter_innenbewegung, in der der Achtstundentag schon seit über 20 Jahren Forderung war, wurde am 3. Mai (der 2. Mai war ein Sonntag) eine Streikversammlung von der Polizei angegriffen, um Streikbrecher_innen den Zugang zu einer Fabrik zu ermöglichen. Dabei tötete die Polizei sechs Arbeiter_innen. In Reaktion auf diese Gewalt kam es am Abend des 4. Mai zu einer Kundgebung auf dem Haymarket, zu der anarchistische Gewerkschaftler_innen aufriefen. Als die Polizei die Versammlung angriff, wurde ihnen eine Bombe entgegengeworfen, die einen Polizisten tötete. Daraufhin schoss die Polizei in die Menge, zahlreiche Arbeiter_innen wurden verletzt, mindestens vier starben, aber auch zahlreiche Polizisten wurden durch die Gegenwehr der Arbeiter_innen verletzt.
Am nächsten Morgen durchsuchte die Polizei die „Arbeiter-Zeitung“, acht Anarchisten wurden festgenommen, und, wie die FAU Thüringen in ihrem Aufruf schon darstellte, ohne stichhaltige Beweise verurteilt: Fünf zum Tode, drei zu Haftstrafen. Es dauerte noch weitere 51 Jahre, bis der Achtstundentag der gesetzliche Normalarbeitstag wurde.
1919, Hamburg/München
Im Zuge der versuchten Revolution im November 1918 bildeten sich auch in Hamburg Arbeiter- und Soldatenräte, die am 6. November die zentralen Punkte der Stadt besetzten und deren Regierungsgewalt vom bürgerlichen Hamburger Senat anerkannt wurde. 10 Tage später setzte die SPD gegenüber den Räten durch, dass die Macht wieder in die Hände des Senats gelegt wurde. Hamburg blieb formell Räterepublik, am 16. März 1919 erfolgten die ersten allgemeinen Wahlen. Die SPD gewann 50,5% der Stimmen und bildete, zum Beweis der Verlässlichkeit ihrer antirevolutionären Haltung dennoch eine Regierung zusammen mit den bürgerlichen Parteien; 1. Bürgermeister bleibt Werner von Melle, denn, so der SPD-Spitzenkandidat: „An die Spitze des hamburgischen Staates gehört ein Mann, der auch den alten Familien nahesteht“. Die neu-alte Regierung führte Hamburg zurück in den Reichsverbund. Als Ersatz für die proletarische Revolution wurde 1919 der 1. Mai zum gesetzlichen Feiertag, der die Arbeiter_innen mit der Ausbeutung versöhnen sollte.
Während in Hamburg gefeiert wurde, wurde die Münchner Räterepublik, laut SPD-Ministerpräsidenten Hoffmann eine „Diktatur der Russen und Juden“, von Freikorps- und Reichswehrverbänden (letztere unter der Führung des SPD-Reichswehrministers Noske) eingeschlossen und am 3. Mai vollständig erobert. Die Münchner Räterepublik endete als letzte Räterepublik in Deutschland. Zwischen 600 und 1000 Menschen starben als Kämpfer_innen der Räterepublik oder wurden als tatsächliche oder vermeintliche Revolutionäre ohne Prozess hingerichtet. Weitere 2200 wurden zu Haft- oder Todesstrafen verurteilt.
1933, Berlin
In der NS-Zeit wurde der 1. Mai deutschlandweit zum gesetzlich verankerten Feiertag. Er wurde durch ein Reichsgesetz vom 10. April 1933 zunächst als „Tag der nationalen Arbeit“ eingeführt und am 1. Mai 1934 zum „Nationalen Feiertag des deutschen Volkes“ erklärt. Ziel war dabei nicht der Ausgleich mit der Arbeiterbewegung, sondern ihre Vereinnahmung und Zerschlagung. Am 2. Mai 1933 wurden die Gewerkschaften in Deutschland verboten und Gewerkschaftshäuser gestürmt. Schon zuvor, am 21. März 1933, d.h. kurz nach der Machtübertragung an die NSDAP und den Reichstagswahlen Anfang März, hatte der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) angeboten, sich „in den Dienst des neuen Staates zu stellen“. Außerdem erklärte er sich am 29. März für parteipolitisch neutral. Im Zuge dieser Anpassungspolitik rief der ADGB auch zur Beteiligung an den Maifeierlichkeiten 1933 auf, während bereits kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre verhaftet und in Konzentrationslager gebracht wurden. Allein an der zentralen Veranstaltung der überall in Deutschland stattfindenden Maifeiern auf dem Tempelhoffeld in Berlin nahmen 1-1,5 Mio. Menschen teil – unter ihnen auch zahlreiche organisierte Gewerkschafter_innen und Mitglieder des ADGB.
1968, Paris
Nach andauernden Studierendenprotesten und -streiks wurde im Anschluss an den 1. Mai am Folgetag die Universität Nanterre geschlossen, eine Protestveranstaltung gegen die Schließung in Paris wurde von der örtlichen Universität untersagt. Daher wurd am 3. Mai die Sorbonne besetzt und am selben Tag von der Polizei geräumt, 200 Studierende wurden festgenommen. Im Anschluss kam es in Paris zu Straßenschlachten und am 5. Mai zu landesweiten Stu-dierendenprotesten, von denen sich die Kommunistische Partei Frankreichs (KPF) distanzierte, da sie sich ihrem Führungsanspruch entzogen. Nach weiteren Unruhen räumte die Polizei am 10. Mai das Quartier Latin und nahm 500 Menschen fest. Die Gewerkschaften solidarisierten sich mit den Protesten und riefen für den 13. Mai zum Generalstreik auf. Am 14. Mai kam es zu zahlreichen Besetzungen von Unis und Schulen, die Arbeiter_innen einer Flugzeugfabrik in Nantes nahmen ihre Arbeit nicht wieder auf und streikten wild. Studierende und Arbeiter_innen kooperierten, die Streiks dehnten sich aus und am 16. Mai rief das Besetzungskomitee der Sorbonne auf:
„Besetzung der Fabriken, Alle Macht den Arbeiterräten, Abschaffung der Klassengesellschaft, Nieder mit der spektakulären Warengesellschaft, Abschaffung der Entfremdung, Ende der Universität.“
Am 17. waren 200.000 im wilden Streik, am 18. schon zwei Millionen. Am 24. bot die Regierung Reformen des Bildungssystems und massive Lohnsteigerungen an, parallel wollten sie und die KPF ein Demonstrationsverbot beschließen. Am 30. lies Präsident de Gaulle sich öffentlich die Loyalität des Militärs versichern, nachdem schon Truppen um Paris zusammengezogen wurden, und drohte mit dem Ausnahmezustand. Als die Gewerkschaften umschwenkten und die Arbeiter_innen aufforderten, ihre Arbeit wieder aufzunehmen, bröckelte der Streik. Die Gewerkschaften behielten vorerst ihre Rolle als anerkannter Verhandlungspartner, die verbliebenden Streikenden wurden bis zum 18. Juni Stück um Stück von der Polizei aus ihren Fabriken geräumt.
⁂
An den hier dargestellten Ereignissen zeigt sich immer wieder auf unterschiedliche Weise: Die Geschichte des 1. Mai ist keineswegs eine Geschichte der Siege progressiver politischer Bewegungen – der 1. Mai ist die Geschichte ihrer Niederlagen. Die Niederlage der amerikanischen Arbeiter_innen gegen staatliche Repressionen und Klassenjustiz, der Verrat der Sozialdemokratie an den Räterepubliken, das Aufgehen der Gewerkschaften und vieler Arbeiter_innen in die nationalsozialistische Volksgemeinschaft, das in der Shoah mündete, und die Niederringung der Selbstorganisation der 68er Proteste in Frankreich, Hand in Hand durch Polizei, die kommunistische Partei und die Gewerkschaften.
Völlig geschichtsblind mutet daher die Formulierung des DGBs zum 1. Mai 2013 an, wenn sie diesen Tag als den Seinigen deklarieren. Damit leugnet er die Rolle der Gewerkschaften, in diesem Falle der ADGB, im frühen „Dritten Reich“. Denn viele organisierte Gewerkschaftler_innen beteiligten sich am 1. Mai 1933 an den zentralen NSDAP-Kundgebungen. Und auch wenn der DGB mit dem Slogan „Gute Arbeit. Sichere Rente. Soziales Europa.“ in „seinen“ „Tag“ startet und eine europäische Solidarität einfordert, ist seine Politik eine andere. Zusammen mit der Sozialdemokratie setzt er auf eine deutsche Solidarität, statt sich mit den Arbeiter_innen Griechenlands, Portugals etc. zu solidarisieren. Die Gewerkschaften setzten sich eben weder für eine Steigerung der deutschen Stückkosten qua ernsthaften Lohnerhöhungen ein, um ihren Standortvorteil gegenüber diesen Ländern zu reduzieren und deren Lage etwas zu entspannen, noch beteiligen sie sich an europaweiten Protestaktionen. Sie verteidigen einzig nationalistische Interessen der deutschen Arbeiter_innen. Hier zeigen sich die Grenzen der vielbeschworenen „Idee Europa“, wenn nationalistische Interesse gegenüber globaler Solidarität überwiegen.
Insofern ist es absurd und falsch, wenn immer wieder den Neo-Nazis von jenen Gewerkschaftler_innen und Sozialdemokrat_innen vorgeworfen wird, sie rauben den 1. Mai und versuchen seine „gute“ Tradition für ihre Zwecke zu nutzen. Das Motto der Freien Kräfte Thüringen „Arbeit zuerst für Deutsche“ entspricht damit der gegenwärtig praktizierten Politik der Gewerkschaften: Ihnen geht es ebenfalls darum, ihre deutschen Interessen in der globalen Standortkonkurrenz durchzusetzen, dabei nehmen sie eine massenhafte Verelendung großer Teile der Bevölkerung etwa in Spanien und Griechenland in Kauf.
Letztlich ist diese Politik Ausdruck einer deutschen Volksgemeinschaft, die sich vom rechten politischen Spektrum bis weit ins linke erstreckt: Sie findet ihren wirkmächtigen Ausdruck im „sozial-partnerschaftlichen“ Korporatismus des DGBs, in der „nationalen Sozialdemokratie“ der SPD wie bei Die Linke – wenn etwa Lafontaine gegen Fremdarbeiter_innen hetzt oder Wagenknecht gegen den „Kasinokapitalismus“ den besseren, deutschen Kapitalismus herbeisehnt – sowie in der aktuellen Europapolitik der CDU/FDP-Regierung, die die deutsche Vorherrschaft in Europa abfeiert, wenn sie sich freut, dass in Europa wieder „deutsch gesprochen“ wird; und natürlich in der neugegründeten „Alternative für Deutschland“, die die D-Mark wieder einführen will, und nicht versteht, inwiefern der Euro Instrument der Durchsetzung deutscher Interessen war und ist.
Es gilt also nicht „unseren“ 1. Mai gegen die Nazis zu verteidigen, sondern im Gedenken an die Geschichte des Tages den Volksgemeinschaftsgedanken zu bekämpfen. Dass dabei der Widerstand gegen Neonationalsozialist_innen und Faschist_innen unabdingbar ist, zeigt die Geschichte ebenso wie die derzeitige Lage etwa in Griechenland oder Ägypten. Bei ihnen darf die Auseinandersetzung aber nicht enden, der 1. Mai erinnert ebenso daran, dass der wirklichen Bewegung mehr als nur Nazis, und auch mehr als Staat und Kapital, entgegenstehen.
Dementsprechend muss der 1. Mai als ein Tag der Niederlage progressiver Politik verstanden werden:
Der 1. Mai ist auf jeden Fall kein Feiertag – der 1. Mai ist ein Gedenktag.
⁂
Club Communism